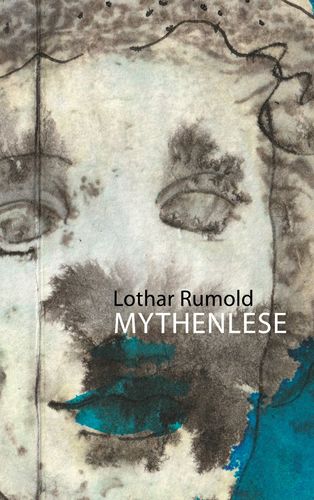5. Juni 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
War es für eine Abtreibung schon zu spät gewesen? Nach dem Dafürhalten nicht weniger Freunde der Menschheit als Idee sollte es für einen Schwangerschaftsabbruch nie zu spät und selten zu früh sein – letzteres etwa dann, wenn die Zeugung noch gar nicht stattgefunden hat. Die Geschichte von der Nicht-Abtreibung des Paris scheint den Frist-Maximalisten recht zu geben. Denn wäre der Prinz von Troja gar nicht erst zur Welt gekommen, hätte es keinen Trojanischen Krieg gegeben. Oder doch nicht mit dem mythologisch verbürgten Personal an dem von Homer angegebenen Ort. Der Trojanische Krieg hätte vielleicht in Byzantion stattgefunden und nicht zehn, sondern nur fünf Jahre gedauert. Und womöglich wäre die Zahl der Opfer und Kriegsversehrten um die Hälfte niedriger, vielleicht aber auch doppelt so hoch gewesen.
Als Hekuba oder das Hekable, wie sie von ihren ins Schwäbische ausgewanderten Verwandten liebevoll genannt wurde, wieder einmal schwanger war, hatte sie einen Traum, in dem sie, die Königin von Troja, ein brennendes Stück Holz gebar, aus dem schlangenförmige Flammen züngelten. Zeus weiß warum – ihr medial begabter Stiefsohn Aisakos riet der aktuellen Frau seines Vaters Priamos nicht zur Abtreibung, sondern zur Tötung des Kindes gleich nach der Geburt. Sonst werde sein Halbbruder mitursächlich verantwortlich sein für die Zerstörung Trojas.
Hekuba übergab das Neugeborene „schweren Herzens“, wie es im nicht-öffentlichen Teil der Akten des Stadtarchivs hieß, einem Sklaven ihres Vertrauens, der es im Wald entsorgen sollte. Denn an Nachwuchs herrschte kein Mangel – der noch namenlose Gefährder hatte oder würde noch haben um die fünfzig Geschwister und Halbgeschwister. Wahrscheinlich hatte die Wöchnerin sich nicht klar genug ausgedrückt, denn der Säugling landete nicht tot oder noch lebendig im Gebüsch, sondern in den Händen des Waidmanns Agelaos beziehungsweise an der Brust von dessen Gemahlin, einer Bärin von einer Frau. Sie war es auch, die Paris den Namen Paris gab.
Der Rest ist – nicht nur, aber auch – Ilias. Der Milch-Sohn der Bärin wuchs heran und fand nach einer ersten, nicht wirklich standesgemäßen Ehe mit der Nymphe Oinone und nach einem Um-einen-Stier-Kampf in den Schoß seiner ursprünglichen königlichen Herkunftsfamilie zurück; kürte Aphrodite zur schönsten Göttin des Olymp; begegnete der mit Menelaos verheirateten Helena, die mit ihm nach Troja durchbrannte; verteidigte die Stadt zehn Jahre lang recht und schlecht – einige sagten: ein wenig lustlos – gegen Helenas Verfolger und erklärte Rückeroberer; wurde von einem vergifteten Pfeil getroffen und starb wegen unterlassener Hilfeleistung durch seine erste Frau Oinone.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 37
Weitere Leseproben hier
29. Mai 2025 | dies & das, Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Bevor Zeus Okyroë wegen unerlaubter Wahrsagerei in eine Stute – eigentlich müsste man sagen: Voll-Stute – verwandelte und sie den Namen Hippo erhielt, war sie eine Art Kentaurin, also eine hals- und kopflose Stute mit dem Oberkörper einer Frau. Eine Kentaurin war Okyroë alias Hippo allerdings nur der Gestalt nach, weil diese Einschränkung auch für ihren Vater Chiron oder Cheiron galt, der seine genealogisch bedingte morphologische Besonderheit an seine Tochter weitergegeben hatte. Als veritabler und nicht nur Pseudo-Kentaur hätte Cheiron seinen Stammbaum auf den Wolken-Stecher Ixion zurückführen können müssen, dem es in angetrunkenem Zustand gelungen war, eine Nephele (das heißt „Wolke“), die er für Hera hielt, zu schwängern. Dabei entstand Kentauros und aus Kentauros‘ Verbindung mit diversen Stuten gingen dann die eigentlichen oder Original-Kentauren hervor.
Die Hand (altgriechisch „cheiro“) der Hände aber hatte mit alledem nichts zu tun. Denn Cheiron war ein Sohn des Kronos, das heißt ein Enkel von Gaia und Uranos (also gewissermaßen ein Urenkel des Chaos) und als solcher ein Halbbruder von Zeus. Die Kentauromorphie verdankte Cheiron dem Umstand, dass sein Erzeuger Kronos sich weder von seiner Gemahlin Rhea noch von sonst jemandem beim Fremdgehen erwischen lassen wollte und Cheirons Mutter Philyra daher in Pferdegestalt erst den Hof und dann den Hengst machte. Neun, zehn oder elf Monate später mit dem Resultat des im wörtlichen Sinn abartigen Seitensprungs konfrontiert, wollte Philyra fortan lieber am Brunnen vor dem Tore eine Linde (Tilia) als die Mutter dieser – in ihren Augen – Missgeburt sein.
Wie sich später herausstellte, war Philyras Entscheidung für die Metamorphose – also für eine Art postnatal-symbolische Abtreibung – vermutlich voreilig gewesen. Denn Cheiron erwies sich als äußerst patenter Mann, den sie gelegentlich Pferd nannten, und auf den so ziemlich jede andere Mutter stolz gewesen wäre. Spätestens beim Lesen des Wikipedia-Eintrags ihres Sohns hätte Philyra ihre Tiliafizierung bedauert: „Er ist ein Freund der Götter, Erzieher der Heroen Jason, Aktaion, Aristaios, Achilleus, Kephalos, Meilanion, Nestor, Amphiaraos, Peleus, Telamon, Meleagros, Theseus, Hippolytos, Palamedes, Menestheus, Odysseus, Diomedes, Kastor, Polydeukes, Machaon, Podaleirios, Antilochos und Aineias, besitzt Kenntnisse in der Arzneikunde, galt gelegentlich als Begründer der Chirurgie und übernahm die Ausbildung des Asklepios zum Arzt.“
Der im unpräzisen Sinn von Vollständigkeit Vollständigkeit halber soll nicht ungesagt bleiben, dass Cheirons Tod im unpräzisen Sinn von tragisch tragisch, nämlich ein Kollateralschaden war. Ein vergifteter Pfeil des Herakles traf ihn am Knie, nachdem der kraftstrotzende Held sich beim Einfangen des Erymanthischen Ebers mit irgendwelchen Original-Kentauren angelegt hatte. Das ist noch nicht die ganze Geschichte, muss für hier und jetzt aber als leidvolles Ende vom Lied genügen. Mythograph sein heißt, vom Eckchen aufs Steckchen und vom Hölzchen aufs Stölzchen zu kommen und eigentlich kein Ende finden zu können.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 35
Weitere Leseproben hier
22. Mai 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Beim Gang durch die, wie man meinen könnte, einem Bauplan von Maurits Cornelis Escher folgenden Räume des Mythologischen begegnen einem immer wieder Akteure, über die man allein schon ihres Namens wegen eine, also ihre Geschichte erzählen möchte. Amphiaraos ist so ein Fall oder, beinahe verheißungsvoller noch: Parthenopaios. Beide Namensträger gehörten zu den Sieben gegen Theben. Und für beide nahm das von Polyneikes, einem der unseligen, da inzestuös gezeugten Söhne des Ödipus, angezettelte thebanische Abenteuer kein gutes Ende.
Weil sie ihn nach seiner Selbst-Blendung und seiner anschließend verfügten Verbannung aus Theben schmählich im Stich gelassen hatten, verfluchte Ödipus seine beiden Söhne Eteokles und Polyneikes. Durch das Schwert des jeweils anderen sollten sie nach Ödipus‘ rachsüchtigem Willen zu Tode kommen. Der Versuch des Polyneikes, unter Mithilfe der sechs anderen altgriechischen Samurai die Herrschaft in Theben an sich zu reißen, schuf also nur die äußeren Rahmenbedingungen für die Möglichkeit der Realisierung dieser unväterlichen Option. Mitgegangen, mitgehangen. Warum Parthenopaios als einer von sieben Verlierern mit in den Krieg gegen Theben gezogen ist? Eine noch präembryonal zu verortende Traumatisierung wäre womöglich ein triftiger Grund, warum einer ein dubioses Angebot wie das folgende nicht ablehnen konnte: Komm mit, sagte Polyneikes zu Parthenopaios, etwas besseres als das, was wir gleich zu Beginn unseres Daseins erleben mussten, werden wir überall finden.
Die Zeugungs-Schande des Polyneikes ist hinreichend erörtert worden, ohne sie wäre die Psychoanalyse heute nicht das, was sie ist. Worin aber bestand die Schmach bei der Entstehung des Parthenopaios? Auch in seinem Fall war eine kategorische rote Linie unbeachtet geblieben – nicht die sexuelle Kontakte ausschließende Grenze zwischen Eltern und Kindern, sondern die Scheidelinie zwischen den Arten. Wenn ein Löwe eine Löwin begattet, sollte dabei kein Mensch heraus kommen, was bei Parthenopaios aber geschehen ist.
Mit Hilfe der Aphrodite war es Parthenopaios‘ zu diesem Zeitpunkt noch nicht vierbeinigem Vater Meleagros gelungen, schneller zu laufen als seine zukünftige Gemahlin Atalante, zu deren Gewohnheiten es gehörte, Heiratskandidaten erst beim Wettrennen zu schlagen und anschließend zu töten. Als Atalante sich gleich nach ihrer Niederlage ein wenig überstürzt im Tempel der Aphrodite von ihrem Bezwinger übermannen ließ, bestrafte die eben noch wohlwollende Aphrodite diesen Verstoß gegen ihre Hausordnung mit Verwandlung in eine andere Spezies. Da sie wie alle antiken Griechinnen und Griechen noch wusste, dass ein Löwe nur mit einer Leopardin, nicht aber mit einer Löwin kann, fiel ihr trotz der damals noch viel größeren Artenvielfalt die Wahl nicht schwer – bestand Aphroditens perfide Absicht doch darin, das Paar, dessen Paarung sie eben erst ermöglicht hatte, im nächsten Moment erotisch-sexuell für immer getrennte Wege gehen zu lassen und dabei wie zum Hohn den äußeren Schein der Zusammengehörigkeit zu wahren.
Der spätere Mitstreiter des Polyneikes wurde gleichwohl gezeugt und kam zur Welt. Psychisch wie physisch war er ein Mensch. Psychisch, indem er traumatisiert, physisch, indem er einerseits nicht irgendeine andere Spezies, andererseits aber auch nicht nichts war. Wofür es aus meiner Sicht nur eine Erklärung gibt: Parthenopaios‘ Vater war noch früh genug und Aphrodite zu spät gekommen. Im Klartext: Die perfide Verwandlung in ein nach antikem Wissen fortzeugungsunfähiges Löwenpärchen fand erst postkoital statt, wobei die Vorgänge zwischen Besamung und Geburt aus Gründen der mythologischen Distanz und der fehlenden einschlägigen Forschungsergebnisse im Dunkeln bleiben müssen.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 33
Weitere Leseproben hier
15. Mai 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Man muss kein Holzbildhauer oder Antiquitätenhändler sein, um sich für eine Geschichte zu interessieren, in der eine hölzerne Statue vom Himmel fällt oder schon gefallen ist. Solches soll der Fall gewesen sein auf der Krim, damals noch Tauris genannt. Der literarhistorisch reale Kontext des mythisch-fiktiven Ereignisses ist die im fünften vorchristlichen Jahrhundert entstandene Tragödie „Iphigenie bei den Taurern“ des zu seiner Zeit mit Literaturpreisen überhäuften Dichters Euripides.
Rache-Morde und zunächst kein Ende. Agamemnon opfert aus, wenn man so will, meteorologischen Gründen in Aulis seine Tochter Iphigenie, weshalb ihn seine Gattin Klytaimnestra, als er zehn Jahre später aus dem Trojanischen Krieg heimkehrt, mit dem Beil erschlägt. Klytaimnestra wird dafür ihrerseits von ihrem Sohn Orestes mit dem selben Schwert getötet, mit dem Orest kurz zuvor Klytaimnestras Liebhaber Aigisthos den Kopf abgeschlagen hat. Dabei hatte Orest seinen Vater Agamemnon nie wirklich kennengelernt. Als er geboren wurde, kämpfte sein Erzeuger schon seit ein paar Wochen oder Monaten in Kleinasien, um die Herausgabe seiner Schwägerin Helena zu erzwingen. Und in den wenigen Stunden, die zwischen der Heimkehr Agamemnons und seiner Ermordung durch Klytaimnestra lagen, wird für den Aufbau einer verbindlichen Vater-Sohn-Beziehung kaum genügend Zeit gewesen sein.
Tu‘ es nicht, hatte Pylades seinen Freund Orest beschworen. Du musst es tun und du wirst es tun, hatte dagegen das Orakel in Delphi apodiktisch verkündet. Was blieb Orestes da anderes übrig, als zur Tat zu schreiten und zum Schwert zu greifen, zumal das Orakel nur das bestätigt hatte, was ihm auch von seiner Schwester Elektra mehr be- als empfohlen worden war. Aber kaum hatte Orest seine Mutter ins Jenseits befördert, fuhren von dort her kommend die Erinnyen in ihn ein und der Mutter-Mörder wurde die Rache-Furien fürs erste nicht wieder los. Erst als er zusammen mit Pylades die eingangs erwähnte Holzfigur, übrigens eine Darstellung der Göttin Artemis, nach Athen ent- und überführt hatte, entspannte sich die Lage nachhaltig.
Um alle Aspekte dieser komplexen Tragödie, die Züge einer schaurigen Rache-Komödie nicht ganz verhehlen kann, gebührend zu würdigen, müsste natürlich zumindest noch erwähnt werden, dass in Tauris die tot geglaubte Iphigenie ironischerweise als opferwütige Artemis-Priesterin tätig war. Die Göttin hatte vor Jahr und Tag auf Iphigeniens Schlachtung im letzten Moment verzichtet und sie von Aulis nach Tauris teleportiert. Hätte der Rache-Reigen im Sinne des Vendetta-Gedankens seinen Sinn behalten sollen, hätte Orestes dort auf jeden und jedes treffen dürfen, nur nicht auf Iphigenie. In Tauris schloss sich ein Kreis, der sich nicht hätte schließen dürfen, falls die Logik der Rache nicht allen Orakel-Sprüchen zum Trotz einer peinlichen Befragung durch die unberechenbare Wirklichkeit hätte unterzogen werden sollen – hätte, hätte, Totschlag-Kette. Aber das nur nebenbei.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 32
Weitere Leseproben hier
8. Mai 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Sie hatten sich in Aulis versammelt und nun warteten sie auf Wind. Denn ohne Wind keine Überfahrt nach Kleinasien; um Helena zu befreien, wie es offiziell hieß. Doch kommt man der Wahrheit möglicherweise ein gutes Stück näher, wenn man sagt: um Menelaos‘ davongelaufene Frau zurückzuholen, denn so ganz unfreiwillig war die schönste Frau der Mythen-Welt ihrem Prinzen, dem als Entführer getarnten Trojaner Paris, wohl nicht in die Fremde gefolgt.
Wer sich mit Google Street View durch Aulis und Umgebung klickt, bekommt eine Ahnung davon, wie das gewesen sein könnte. Die hochgerüsteten und zunächst auch noch mittelhoch motivierten Kämpfer waren gekommen, um den düpierten Menelaos zu rehabilitieren, und nicht um heldenhaft der Hitze und der Langeweile zu trotzen. Noch drei, vier Tage Flaute und die ersten wären wieder nach Hause gefahren. Allen voran wahrscheinlich Odysseus, der sich auf das trojanische Abenteuer ohnehin nur widerstrebend eingelassen hatte. Als seine zukünftigen Kampfgefährten kamen, um ihn abzuholen, wollte er sie glauben machen, er habe nicht mehr alle Amphoren in der Speisekammer und war mit Ochs und Esel vor dem Pflug, dabei Salzkörner säend, durch den Sand gestolpert. Doch wurde der dann doch noch nicht ganz so Listenreiche von Palamedes umstandslos als wortbrüchiger Drückeberger enttarnt und, wenn schon nicht mit gezogenem Schwert, so doch mit geschwungener Ethos-Keule zum Kriegsdienst überredet.
Was also tun? Agamemnon, bei dem die oberste Heeres- und Marineleitung lag, sah nur noch einen Ausweg – es musste jetzt schon Blut fließen, und zwar Menschenblut. Die in Aulis verehrte Göttin war Artemis; ihr wollte Agamemnon, da zeigte er sich großzügig, seine Tochter Iphigenie im Tausch gegen eine frische Brise anbieten. In der vom Militär-Seher Kalchas verbreiteten Version des Deals hieß es, Agamemnon habe beim Jagen mehr oder weniger aus Versehen einen Hirsch der Artemis erwischt und die habe dann in Absprache mit Poseidon ein Segelverbot erlassen, daher die Windstille. Seefahrt werde es erst wieder geben, wenn Agamemnon ihr seine Tochter Iphigenie als Opfer darbringe. Was bleibe Agamemnon, so Kalchas, also anderes übrig, als der Göttin um des lieben Krieges willen den Gefallen zu tun. Punkt, kein Fragezeichen.
Das Menschenopfer verfehlte seine vermeintliche Wirkung nicht. Kaum war das Mädchen tot, erhob sich ein leichter Westwind. Einige sagten später hinter vorgehaltener Hand, der habe schon zu wehen begonnen, als der Priester noch das Messer wetzte, das er dann an Iphigeniens Kehle setzte.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 31
Weitere Leseproben hier