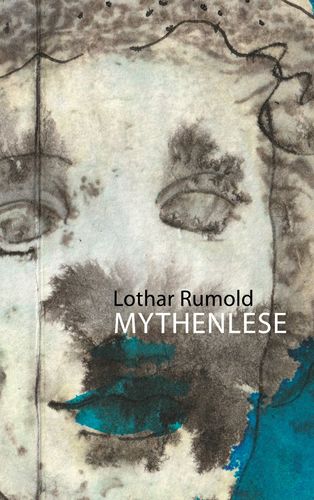5. August 2025 | Recycling
Der nachfolgende Text entstand 2014/15 auf Anregung von Markus Jäger im Zusammenhang mit einem Kunstprojekt von Markus Jäger und ONUK Bernhard Schmitt. Näheres dazu bei Markus Jäger: ↗
„Alles Geschehen ist einmalig und nie sich wiederholend. Es trägt das Merkmal der Richtung (der „Zeit“), der Nichtumkehrbarkeit. Das Geschehene, als nunmehr Gewordnes dem Werden, als Erstarrtes dem Lebendigen entgegengesetzt, gehört unwiderruflich der Vergangenheit an.“
Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes
Über Recycling
Recycling könnte man allgemein bezeichnen als den Versuch, die von Oswald Spengler behauptete Nichtumkehrbarkeit der Geschehnisse zu relativieren, die Unwiderruflichkeit des Verdikts Aus-und-vorbei infrage zu stellen. Im Gegensatz zur Arithmetik der Antike, so Spengler weiter, kenne die abendländische Analysis die „Konzeption einer veränderlichen Zahl, die unterhalb jeder von Null verschiedenen endlichen Größe sich bewegt, selbst also nicht den geringsten Zug einer Größe mehr trägt.“ Dieser Grenzwert, der keinen bestimmten Wert mehr annimmt, ist gewissermaßen der Prozess der Annäherung selbst: „Er ist kein Zustand, sondern ein Verhalten.“ Mit dem Verhalten des Recycling hätte demnach ein Konzept der abendländischen Mathematik eine nicht-mathematische, alltäglich-profane Gestalt angenommen. Denn Recycling ist eher zuerst als zuletzt der Versuch des „Abendlandes“, nicht nur das eigene Untergehen im eigenen Müll, sondern letztlich den Nullpunkt der globalen Katastrophe bis zum Sankt Nimmerleinstag hinauszuzögern: Recycling ist das auf Dauer gestellte Noch-nicht-am-Ende-Sein.
Der recycelte Gegenstand ist Träger einer Substanz, die bei Strafe des „Untergangs des Abendlandes“ nicht vergehen darf. Der jeweils neue Phönix (Laubbläser, HD-Fernseher, Geländewagen), der sich aus der Asche der Plaste und Elaste, der Flaschen, Elektrogeräte und Printprodukte erhebt, verkörpert das Prinzip des ewigen Lebens seiner materiellen Grundlage: Recycling ist die Auferstehung des Fleisches der Produkte in Form neuer Produkte.
Das immer wieder neu Gewordene und zu neuer, anderer Form Vergegenständlichte ist zugleich das stets aufs Neue Tote. So haftet dem Wiederholungsvorgang – im Idealfall ad infinitum – zugleich ein Aspekt des Wiedergängerischen und Untoten an. Recycling realisiert das Paradox des lebendig Toten: Recycling ist Wiedergängertum im Zeitalter seiner technischen Produzierbarkeit.
Durch die hoffentlich endlose Folge von Wiedergeburten der Artefakte wird, wie schon erwähnt, der Zeitpunkt des finalen perdu ad infinitum hinausgeschoben. Schlechte Zeiten für die Produktseele, die sich zum Buddhismus bekennt: Recycling ist Buddhismus minus Nirwana.
Wer über Recycling spricht, wird von Nachhaltigkeit nicht schweigen wollen. Nachhaltig sind Produkte dann, wenn ihren Produktionsbedingungen das Ideal des Perpetuum mobile zugrunde liegt. Recycling kann dabei helfen, das Ideal zu verwirklichen. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns, dass wir in der Vergangenheit so vieles unwiederbringlich weggeworfen haben, anstatt es in den keineswegs teuflischen Zirkeln der Produktions-Konsumtions-Ketten endlos rotieren zu lassen. Aus Output wird Input wird Output wird Input. Wo einmal Abfallpolitik nötig war, ist nun der Zugang zu einer anderen Art von Rohstoff zu organisieren und zu regeln: Recycling ist Nachhaltigkeit ist Erlösung vom Übel der Mülldeponie.
Wenn schon der emaillierte Aschenbecher von 1913 „teils zum Schmuck und teils zum Rauchen“ (Kurt Tucholsky) gewesen ist, wie schmuck (schön) wird dann erst, abgesehen von seinem praktischen Nutzen, der recyclierte Schirmständer aus Sekundär- und Tertiärrohstoffen sein, der heute für kurze Zeit am Ende eines Systems von aufeinanderfolgenden und ineinandergreifenden Wiederverwertungsprozessen steht. Denn die ökopolitische Schönheit der Produkte aus nicht-primären Rohstoffen ist mittlerweile Common Sense: Recycling is beautiful.
Über Noncycling
Eine neue Gesteinsart, ein Konglomerat aus Plastik, vulkanischem Gestein, Sand, Muscheln und Korallen, wurde 2014 an der Küste von Hawaii entdeckt. Die kanadische Geologin Patricia Corcoran erfand, besser gesagt: konglomerierte dafür den Namen plastiglomerates. Man kann in jenen hybriden Klumpen offenbar die eingebackenen ehemaligen Zahnbürsten, Gabeln, Seile und noch manches mehr gut erkennen. Wenn die zivilisationsbedingten Bestandteile fürs erste unauflöslich mit den schwereren natürlichen Materialien verschmolzen sind, sinkt das neue Gestein auf den Meeresgrund, wird Teil der Erdgeschichte und hat somit gute Chancen, zukünftigen Forschern Rätsel aufzugeben.
Bevor sie auf dem Meeresgrund landeten, trieben die Plastikteile womöglich im Great Pacific Garbage Patch (Großer Pazifischer Müllfleck), den man vom hawaiianischen Midway-Atoll aus gut beobachten könnte, falls das US-Militär den Zugang gestatten würde. Insgesamt fünf große Meeresdriftströmungswirbel gibt es weltweit und man muss wohl annehmen, dass in jedem dieser Strudel einige hunderttausend der insgesamt acht Millionen Tonnen Kunststoffmüll mitbewegt, in Verbindung mit UV-Licht nach und nach pulverisiert und schließlich in die menschliche Nahrungskette eingegliedert werden. Zukünftige Anthropologen werden sich womöglich der Tatsache stellen müssen, dass der Mensch nicht nur im zivilisatorisch-kulturellen Sinn, sondern bis in die Feinstruktur seiner Physis hinein Resultat menschlichen Handelns ist. Die nicht erst jetzt problematisch gewordene Unterscheidung zwischen Natur und Kultur wird weiter an Überzeugungskraft verlieren.
Alles bewegt sich, alles dreht sich. Wo es um Recycling geht, ist von Rotation vor allem metaphorisch die Rede, wo es um die Müllstrudel der Weltmeere geht, ist die Kreisbewegung des Plastikmülls fotografisch abbildbare Wirklichkeit. Vom sprachlichen wie vom fotografischen Bild wird nahegelegt, sich dem Thema Recycling (einschließlich Non-Recycling oder Noncycling) kreisförmig zu nähern. Markus Jäger und Bernhard Schmitt haben dies getan. Ihre künstlerischen Materialversammlungen der relikte Serie (seit 2012) kreisen um eine planimetrische Mitte, die als Zentrum darüber hinaus semantisch leer bleibt. Mal sieht es nach einem trägen Sich-im-Kreis-Drehen der Gegenstände aus, mal scheint eine zentrifugal wirkende Kraft diese zu beschleunigen und am Rande der Kreisfläche bereits unterschiedlich weit vom Mittelpunkt weggetragen zu haben.
Über Up- und Downcycling
Recycling heißt im Grund nur, dass aus etwas Altem etwas Neues, aus etwas Verbrauchtem ein Noch-zu-Verbrauchendes, aus Müll beim Durchlaufen der dreistufigen Verwertungskaskade (Sammeln, Sortieren, Aufbereiten) wieder ein verkäufliches Produkt (in der Regel ein Zwischenprodukt) gemacht wird. Bei genauerem Hinsehen kann jedoch mindestens noch zwischen Upcycling und Downcycling unterschieden werden.
Macht man aus einer Flasche wieder eine Flasche, liegt ein Fall von Downcycling vor, da die Qualität des Glases unweigerlich gelitten haben wird. Es wäre eventuell besser gewesen, die Flasche zum Bau eines Hauses zu verwenden oder auch zur Herstellung (zum Schaffen) eines Kunstwerks. „Upcycling“ heißt hier der komplementäre Terminus, der eine Bewegung nach oben, das heißt eine Qualitätssteigerung suggeriert. Die gleichwohl festzustellende Minderung der Glasqualität spielt dabei keine Rolle, da das zum Haus- beziehungsweise Kunst-Bau verwendete Glas nicht mit anderen Glasarten, sondern mit anderen Bau- respektive Kunst-Stoffen zu vergleichen ist.
Zu untersuchen wäre, ob, wann und wo die Müllaufwertung (typischerweise als Papiermüllveredelung auf dem Wege des Kleidungs- oder Möbeldesigns) noch etwas anderes ist als eine Maßnahme zur Erhöhung des Aufmerksamkeitsindexes der Produkte. Mit angeblichem oder Pseudo-Upcycling ist der Welt (aber vor allem der Nachwelt) mittel- und langfristig nicht geholfen, sofern man als authentische Hilfe nur das gelten lassen will, was sich in einer messbaren Reduzierung oder Kompensation schädlicher Effekte niederschlägt.
Über Metacycling
Boris Groys stellte 2003 in seiner Topologie der Kunst fest, die Kunst sei unbestreitbar ein Wirtschaftszweig, daher sei das Kunstwerk „eine Ware wie jede andere“. Auch Recycling ist seit geraumer Zeit ein Wirtschaftszweig, in dem mit spezifischen Produkten und Dienstleistungen Umsätze und Gewinne gemacht werden. Markus Jägers und Bernhard Schmitts Recycling-Bilder-Waren-Produktion gehört in gewisser Weise nicht nur dem einen, sondern auch dem anderen Wirtschaftssektor an. Dass der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) das Künstlerduo als Verbandsmitglied aufnehmen würde, darf allerdings bezweifelt werden. Denn die von Jäger&Schmitt praktizierte Form des Müllrecyclings findet zu hundert Prozent im Symbolraum der Kunst statt, die oben erwähnte Glasflasche würde beim Bau ihrer Werke also gar nicht stofflich real zum Tragen kommen.
Mit dem Hinweis auf den symbolischen Charakter des künstlerischen Endprodukts scheint man als artistischer Re- oder Upcycler peinlichen Fragen nach Qualitätsunterschieden und Energiebilanzen glücklich entronnen zu sein. Wenn der Wert-Stoff Kunst die irdischen Belange transzendiert (das Kunstwerk ist nach Adorno „das Andere der Empirie“ und umgekehrt die stoffliche Wirklichkeit das Andere der Kunst), können Probleme der qualitativen Auf- oder Abwertung im Bereich der Kunst nur metaphysischer Natur sein. Und auch ohne Adorno gelesen zu haben, werden nicht wenige Künstler vom ideellen (kulturellen) Maximalwert der Resultate ihres Schaffens überzeugt sein.
Doch ebenso wie das eigentlich nicht mit Geld zu Bezahlende auf diversen Kunstmärkten zu exakt feststellbaren Preisen die Besitzer wechselt, wird die physisch-empirische (nicht die metaphysisch geschönte) Ökobilanz des künstlerischen Tuns und Lassens (en gros und en détail) früher oder später einer Prüfung zu unterziehen sein. Marcel Duchamps Urinal wird einmal mehr besser wegkommen als der berühmt-berüchtigte Ölschinken, insbesondere dann, wenn dieser vor der Zeit der umweltfreundlichen Farben auf die mit fragwürdigen Verfahren hergestellte Leinwand gebracht worden ist. Die stoffliche Wirklichkeit als ihr Anderes wird die Kunst eines nicht mehr fernen Tages einholen und sie fragen, ob sie nicht eine Chance sehe, bei ihrem Negieren der Realität diese auch materialiter außen vor zu lassen oder doch wenigstens umweltschonender zu behandeln, als das bisher in manchen Fällen der Fall gewesen ist.
Eine Ökobilanz der Werke (Produkte) von Markus Jäger und Bernhard Schmitt hat deren primär digitalen und erst sekundär analogen oder haptischen Charakter in Rechnung zu stellen. Die Instrumente, mit denen sie geschaffen wurden, dienen daneben noch einer Reihe von anderen Zwecken. Ihre Verstofflichung oder Inkarnation ist nicht Bedingung ihrer Existenz, sondern vollzieht sich on demand oder on decision. Das macht, wenn man so will, ihren ökologischen Charme aus. Erst in der nicht-digitalen Phase ihrer Existenz jenseits des virtuellen Raums werden sie zu potentiellem Müll, für dessen ökopolitisch korrekte Entsorgbarkeit von vornherein Sorge zu tragen wäre.
10. Juli 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Odysseus bevorzugte den kuppelförmigen Pilos, ebenso Hephaistos und Charon. Hermes dagegen trug einen sportiver wirkenden, breitkrempig flachen Petasos, in seinem Fall eine exklusive Sonderanfertigung mit seitlichem Geflügel. Exklusiv hieß im wörtlichen Sinn: Wenn einer mit so einem, genauer gesagt mit diesem Hut gesichtet wurde, konnte man ausschließen, dass es sich bei ihm nicht um Hermes handelte. Auch Paris soll bei seiner fatalen Entscheidung für Aphrodite als Schönste der Schönen einen in den Nacken geschobenen Petasos als kleidsames Accessoire mit sich geführt haben. Während Götter und Heroen nicht selten Hüte trugen, scheint selbiges bei Heroinen und Göttinnen nicht üblich gewesen zu sein.
Wilde Männer mit schwarz-dichtem Haupt- und Barthaar samt hervortretender Nase trugen in der Regel weder einen Hut (nicht Pilos noch Petasos) noch eine Chlamys oder sonst einen Umhang. So ein wilder Mann (übrigens ein Sohn von Poseidon) war beispielsweise Sinis – einer der fünf Wegelagerer, die vom jugendlichen Theseus auf seinem Weg in die Hauptstadt von Attika aus Gründen der Imagepflege und der Mythenbildung unter dem Applaus der Umstehenden in den Hades geschickt wurden.
Theseus seinerseits trug beides: einen Petasos und eine Chlamys – einen ärmellosen kurzen Mantel, der über die linke Schulter geworfen und über der rechten mit einer Spange zusammengehalten wurde. Da er als Enkel des reichen Weinbauern Pittheus aufgewachsen war, wird seine Chlamys nicht aus naturfarbener Schafwolle, sondern aus einem feinen Tuch in Schwarz oder Purpur gewesen sein. Und als Sohn aus gutem Hause verstand Theseus es gewiss, den Umhang so über die Schulter zu werfen, dass dieser dabei nicht mit dem Boden oder sonst etwas Unstandesgemäßem in Berührung kam.
An den Füßen aber trug Theseus jene Sandalen, die sein Erzeuger Aigeus nach der Liebesnacht mit Aithra für den Fall der Fälle zusammen mit seinem Schwert unter einem Felsen deponiert hatte. Schwert und Sandalen sollten dem etwa gezeugten Nachkommen zu gegebener Zeit als Vater- beziehungsweise Sohnschaftsnachweis dienen. An seiner Waffe und an seinem Schuhwerk meinte der angehende König von Athen den rechtmäßigen Thronfolger dereinst zweifelsfrei erkennen zu können. Dass Aigeus nicht auch noch seinen Pilos oder Petasos als dritten Beleg mit unter den Felsen geschoben hatte, ist nachvollziehbar. Wenn so ein Filz- oder Strohhut eine ganze Kindheit und Pubertät lang plattgedrückt unter einem Felsen gelegen hatte, würde er, das war Aigeus klar, einen so jämmerlichen Anblick bieten, dass dieser weder dem Sohn noch dem Vater zugemutet werden konnte.
Um nun aber auf den erwähnten Sinis zurückzukommen: der wilde Mann ohne Hut und Mantel machte sich ein makaberes Vergnügen daraus, harmlose Wanderer oder andere Reisende erst dazu zu bewegen, die Wipfel von Nadelbäumen (Fichten, Pinien oder Kiefern) zu Boden zu biegen und sich dann von diesen in die Luft und in den Tod schleudern zu lassen. Wie ihm dieser Trick gelang, weiß man nicht so genau, aber er scheint regelmäßig funktioniert zu haben. Nur bei Theseus muss dann etwas schiefgegangen sein. Denn plötzlich war Sinis selbst derjenige, der mit dem zurückschnellenden Wipfel in die Höhe katapultiert wurde. What goes up must come down: Dem Lehrsatz von Isaac Newton folgend, kam auch Sinis wieder herunter. Und da der Baum ein kräftiger und hoher gewesen war, war Sinis‘ Fall ein tiefer und der Bodenkontakt ein tödlicher.
In der letzten Einstellung sehen wir, wie Theseus sich einmal mehr geschickt die Chlamys über die Schulter wirft, mit dem Petasos ins Publikum winkt und seinen Siegeszug nach Athen fortsetzt. Und falls die Sandalen, die Aigeus für seinen Sprössling in spe unter dem Felsen hinterlegt hatte, Schuhe der Marke Salamander waren, dann muss der Schlusssatz an dieser Stelle lauten: „Lange tönt’s im Walde noch – Salamander lebe hoch!“
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 44
Weitere Leseproben hier
3. Juli 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Als Knabe hieß er „der Schnellfüßige“, später dann „der Freigekaufte“. Noch später hätte er eigentlich „der mit den aberwitzig vielen Kindern“ heißen müssen. Priamos (von „priasthai“ für „kaufen“) war der jüngste Sohn von Laomedon, dem zweiten König von Troja. Laomedon hatte die potentiell selbstzerstörerische Angewohnheit, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und die Dienstleister dann um das vorher vereinbarte Honorar zu prellen. So weigerte sich Laomedon unter anderem, Herakles die ihm versprochenen Pferde zu überlassen. Die standen dem zufällig Vorbeigekommenen zu, weil er ein Seeungeheuer getötet hatte, dem Laomedons Tochter Hesione geopfert werden sollte. Das Seeungeheuer war von Poseidon geschickt worden, aber nur, weil Laomedon ihn für den Bau einer kompletten Stadtmauer partout nicht hatte bezahlen wollte.
Priamos hieß damals noch Podarkes, also „der Schnellfüßige“. Zur Umbenennung kam es erst einige Zeit später, als Herakles nach Erledigung seines Pflichtprogramms zurückkam, um sich in Troja um die Begleichung der noch offenen Rechnung zu kümmern. Statt mit Podarkes‘ Vater Laomedon zu verhandeln, schuf Herakles gleich vollendete Tatsachen und tötete nicht nur den König, sondern auch des Königs Kinder, ausgenommen Hesione, die er nach dem erzwungenen Verzicht auf die Pferde zu seiner Geliebten gemacht hatte. Auch Hesiones Brüder Tithonos und Podarkes kamen mit dem Schrecken davon. Dass Herakles Tithonos verschonte, war ein mythologisch notwendiger Akt der nicht ganz reinen Willkür: Tithonos wurde nämlich noch als Liebhaber von Eos, der Göttin der Morgenröte benötigt. Podarkes dagegen kam nur deswegen mit dem Schrecken und dem Leben davon, weil Hesione ihn gewissermaßen loskaufte. „Auf einen mehr oder weniger kommt es mir nun wirklich nicht an“, sagte Herakles lachend, als Hesione ihren Gürtel löste und ihn Herakles als Lösegeld für den Lieblingsbruder anbot.
Dass Podarkes oder, wie er von nun an hieß, Priamos von Herakles nicht getötet worden war, blieb für die demographische Entwicklung von Troja nicht ohne Folgen. Von seiner Gattin Hekabe und anderen Frauen hatte Priamos fünfzig Söhne und zwölf Töchter, darunter Paris, der durch die Entführung der schönen Helena Troja den Untergang brachte und Hektor, der diesen Untergang heldenhaft, aber letztlich ohne Erfolg, zu verhindern suchte. Die meisten der zweiundsechzig Kinder des Priamos kamen bei der Eroberung der Stadt durch die Griechen ums Leben. Wie gewonnen, so zerronnen, wie geboren, so verloren.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 43
Weitere Leseproben hier
26. Juni 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie, Odysseus
Telegonos, „der in der Ferne Gezeugte“, hatte sich von Aiaia auf den Weg nach Ithaka gemacht, um seinen Vater zu finden und zur Rede zu stellen. Warum hatte er seine Mutter Kirke und damit auch ihn, den schon Gezeugten, aber noch nicht Geborenen, bereits nach einem Jahr wieder verlassen!? Nicht, um ihm sein Leid zu klagen, wie es der Insel-Tradition (nomen est omen) entsprochen hätte, sondern um ihn anzuklagen vor den Göttern und der ganzen alteuropäisch-kleinasiatischen Welt, wollte Telegonos Odysseus gegenübertreten.
In seiner schon auf Aiaia vorbereiteten und während der Reise mit asketischer Beharrlichkeit eingeübten Rede begannen die meisten Sätze mit „Warum hast du“ oder „Warum hast du nicht“ beziehungsweise mit „Wie konntest du nur“ oder „Warum konntest du nicht“. Dabei stellte er sich als Gegenüber einen noch immer gutaussehenden, sportlich durchtrainierten Endfünfziger mit ein paar männlich schmissigen Narben im Gesicht vor, der ihn erst geduldig anhören und dann mit einem verständnisvollen Lächeln tröstend in die Arme schließen würde. Komm mit mir ins Arbeitszimmer, mein Sohn, hatte er ihn immer wieder sagen hören, ich glaube, wir haben einiges miteinander zu besprechen.
Als er dann aber am Strand von Ithaka jenen barfüßigen alten Mann mit dem schütteren grauen Haar und den dünnen Armen sagen hörte, er sei derjenige, welcher hier das Sagen habe, war Telegonos sofort klar, dass es sich bei alledem nur um einen großen Irrtum handeln konnte. Worin genau der Irrtum und Fehler bestand und wem er unterlaufen war, wusste er nicht und wollte er nicht wissen. Jedenfalls durfte das alles nicht wahr sein. Und Telegonos beschloss, fortan keinem kein einziges Wort nicht mehr zu glauben. Nicht seiner Mutter und auch nicht sich selbst. Und erst recht nicht dieser lächerlichen Figur von einem Möchtegern-König und Pseudo-Vater.
Also stellte Kirkes Sohn sich dem Alten in den Weg, zückte seinen Speer und fuhr dem Vater, der nie einer gewesen war und nie einer werden sollte, mit der Speerspitze einmal kreuz und quer durchs Gesicht, um ihm so wenigstens einen Ersatz für die Narben zu verpassen, die der peinliche Ex-Lover seiner Mutter sich im Trojanischen Krieg offensichtlich nicht zugezogen hatte. Die Folgen dieser Ritzungen sind bekannt. Odysseus starb vermutlich an einem allergischen Schock als Reaktion auf das für Menschen im allgemeinen und für Troja-Veteranen im besonderen relativ ungefährliche Stachelrochen-Gift, mit dem die Speerspitze präpariert worden war.
Jahre später, Telegonos war zusammen mit seinem Halbbruder Telemachos (nun der Ehemann seiner Mutter Kirke) und Penelope (die Witwe seines Vaters, die dann Telegonos‘ Frau geworden war) längst wieder nach Aiaia zurückgekehrt, dichtete der vor wie nach jener unglücklichen Episode auf Ithaka Vaterlose ein Poem, in dem er die Beziehung zu seinem Erzeuger aufzuarbeiten versuchte. Der Text wurde erst 1971 bei Ausgrabungen auf Aiaia gefunden. In der Übersetzung von Howard Carpendale und Thomas Horn lauten die Schlüssel-Zeilen des Werks mit dem Titel „Lulelalelula“ folgendermaßen: „Deine Spuren im Sand, / Die ich gestern noch fand, / Hat die Flut mitgenommen. / Was gehört nur noch mir? / Lu le lu le lu lei, / Lu le lu le lu lei, / Hat die Flut mitgenommen, / Lu le lu le lu lei. / Deine Liebe, sie schwand / Wie die Spuren im Sand. / Was ist mir nur geblieben? / Nur die Sehnsucht nach Dir.“
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 41
Weitere Leseproben hier
19. Juni 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie, Odysseus
Von Odysseus weiß man nicht selten nicht viel mehr, als dass er zehn Jahre im Trojanischen Krieg war und dann noch einmal zehn Jahre gebraucht hat, um den Heimweg nach Ithaka zu finden und dort unter den Bewerbern um seine Nachfolge am Tisch und im Bett von Penelope ein Blutbad anzurichten.
Dass der Krieg zehn Jahre gedauert hat, daran sind die Troer schuld, die die schöne Helena nicht kampflos heraus- oder, wie Menelaos es sah, zurückgeben wollten. Für die schier endlos lange Heimreise macht man, selbst wenn man sie nicht namentlich kennt, automatisch die Kikonen, Lotophagen, Kyklopen, Laistrygonen, Sirenen und Phaiaken verantwortlich, mit denen es Odysseus und seine Gefährten auf die eine oder andere Weise zu tun bekamen. In Wahrheit, falls man das gewichtige Wort in diesem Zusammenhang verwenden darf, sind es aber erst Kirke und dann vor allem Kalypso gewesen, die dafür sorgten, dass aus einer ebenso abwechslungs- wie verlustreichen Tour de Méditerranée (theoretisch zu bewältigen in mehreren Etappen von jeweils zwei bis drei Monaten Dauer) jene Grand Tour wurde, die, von Homer erzählt, als „Odyssee“ bis vor kurzem zum Kernbestand des abendländischen Kulturguts gehörte.
Bei der zauberhaften Kirke verbrachte Odysseus zwar nur, wie er später zu Penelope sagte, „ein paar Tage oder Wochen“ (es waren genaugenommen zwölf Monate), doch blieb nach dieser ausgedehnten Rast auf der Klage-Insel Aiaia dort ein Sohn zurück, der den Namen Telegonos erhielt. Von dem namentlich „in der Ferne Geborenen“ und in ihr Zurückgelassenen wurde Odysseus Jahre später auf schicksalhafte Weise eingeholt. Über die sieben mal zwölf Monate bei Kalypso, der „Verborgenen“, dagegen schweigt des Sängers Höflichkeit. Homer lässt Odysseus nur wortkarg resümieren: „Sieben Jahre blieb ich bei ihr, und netzte mit Tränen / Stets die ambrosischen Kleider, die mir Kalypso geschenket.“ Dass der Ärmste der Armen die tränennassen ambrosischen, also eigentlich nur von Unsterblichen zu tragenden Kleider niemals ausgezogen hat, ist nicht anzunehmen. Denn auch aus dieser Begegnung gingen zwei bis sechs Kinder hervor, deren Namen nicht überliefert sind.
Man hat von alledem dieses und jenes irgendwann und -wo einmal gehört oder gelesen. Wer aber kennt schon den alt gewordenen Odysseus, wer weiß schon, wie Odysseus gestorben ist? Auch nach seiner für nicht wenige tödlichen Rückkehr zu Penelope und seinem Sohn Telemachos fand der Kriegsveteran keine Ruhe. Vom Seher Teiresias stammte der Rat, Odysseus solle mit einem Ruder unterm Arm oder über der Schulter so lange ins Landesinnere wandern, bis er in eine Gegend komme, wo man ihn stirnrunzelnd frage, was das denn für ein Brett sei, das er da mit sich herumschleppe. Dort solle er Halt machen, das Ruder in den Boden rammen und, von der pathologischen inneren Unruhe befreit, wieder nach Hause zurück gehen.
Der nicht der Ataraxie, also der epikureischen Seelenruhe fähige Wanderer tat, wie Teiresias ihm geraten hatte. Alles ging reibungslos vonstatten, bis Odysseus sich auf den Nachhauseweg machte. Im allgemeinen kommt einem der Hinweg länger vor als der Rückweg. Bei Odysseus verhielt es sich umgekehrt, ganz einfach deshalb, weil er auch für diese Rückreise wesentlich länger brauchte als für die Anreise. Dieses Mal war es eine schöne Witwe, bei und in der er hängenblieb. Erst Kirke, dann Kalypso, nun eine Königin namens Kallidike. Eine Dynastie wollte sie begründen – und en passant wurde Odysseus zu deren Stammvater.
Schließlich aber kam jener Tag, an dem der nach Ithaka Zurückgekehrte barfuß am Strand spazieren ging, dabei wiederholt aufs offene Meer hinaus sah und über die wirklich wichtigen Dinge nachdachte. Hat das Epos als literarische Form eine Zukunft? Ist die Lyra dazu in der Lage, den neuen musikalischen Herausforderungen gerecht zu werden? Wo er den Chef finde, hörte er plötzlich jemanden fragen. Wer das wissen wolle, fragte Odysseus zurück. Telegonos, antwortete Telegonos. Der Chef heißt bei uns nicht Chef, sondern König des Staatswesens, sagte Odysseus, und sowohl der König als auch l’état – c’est moi. Und ich bin die Lieblingstochter von Poseidon, höhnte der junge Angeber und stellte sich dem barfüßigen Ruheständler breitbeinig in den Weg.
Ja, er komme von der Insel Aiaia und er sei der Sohn der Kirke. Und mit der Speerspitze habe er den nunmehr Toten nur aus Versehen geritzt, sagte Telegonos später aus. Und dass das Gift des Stachelrochens, das sich daran befunden habe, schon in geringer Konzentration tödlich wirke, wundere ihn. Aber ihr Ehemann war ja nicht mehr der Jüngste, sagte er zu Penelope, und dass er mein Vater war, konnte ich nun wirklich nicht ahnen.
Als ihm einige Jahre zuvor von Teiresias der Rat mit dem Ruder gegeben worden war, hatte Odysseus, als er sich schon zum Gehen wandte, aus seherischem Munde ganz nebenbei noch erfahren, sein Tod werde sanft sein und er werde aus dem Meer kommen.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 39
Weitere Leseproben hier