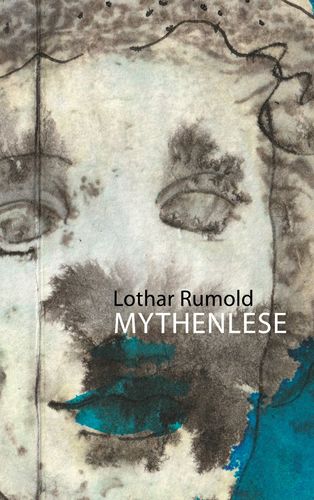19. Mai 2025 | Biedermeier, Romantik, STIFTER Adalbert
Während der PC nach dem Zähneputzen noch ein paar Kniebeugen macht, lese ich weiter in Stifters vor 1857 geschriebenem „Nachsommer“. Der Autor lässt den gastfreundlichen Gutsherrn sagen: „Dort, wohin wir nicht sehen und woher die Wirkungen auf unsere wissenschaftlichen Werkzeuge nicht reichen können, mögen vielleicht Ursachen und Gegenanzeigen sein, die, wenn sie uns bekannt wären, unsere Vorhersage in ihr Gegenteil umstimmen würden.“
Eine zeitgenössische Metapher für dieses Dort lautet „dunkle Materie“ und „dunkle Energie“, womit der moderne Bescheidwisser und erklärte Anti-Romantiker seinem Nichtwissen unter erheblichem matheMAGISCHEM Aufwand einen geheimnislos gegenständlichen Schein zu geben sucht.
Stifters Gutsherr meint sein mit Hilfe der ihm zur Verfügung stehenden Messinstrumente nicht erreichbares Dort allerdings weder metaphorisch noch romantisch. Und falls dieses Dort hinter dem Horizont liegen sollte, dann ist nicht von einer metaphysischen, sondern von einer technisch überwindbaren geographischen Transzendenz auszugehen. Wer das Biedermeier eines Adalbert Stifter eher der Romantik als der beginnenden Moderne zuordnen möchte, sollte seinen „Nachsommer“ noch einmal einem Close reading unterziehen.
16. Mai 2025 | Autopoiesis, Schreiben (über das)
Nach seiner Entstehung bleibt ein Textabschnitt eine ungewisse Zeit lang flexibel wie ein Gebilde aus feuchtem, noch nicht hart gewordenem Ton. Der Satz oder das Satzgefüge ist dann noch formbar, aber vor allem: es formt sich selbst. Man könnte geradezu von der Selbstformungsphase der Sätze oder Satz-Gebilde sprechen. Die Syntax reckt und streckt oder verkürzt sich, Wörter werden ausgetauscht oder rücken wie von selbst an eine andere Stelle, aus einem Verb im Perfekt wird paradoxerweise eines im Imperfekt und umgekehrt. Man muss sich dann als Autor dem Eigensinn der Sätze bloß nicht widersetzen. Darf sich stattdessen als teil- und anteilnehmender Beobachter willig und entspannt zum Erfüllungsgehilfen eines höheren Willens machen oder machen lassen. Man kann zwischendurch auch mal aufs Klo gehen, den Müll runterbringen oder einen Berg besteigen. Die Autopoiesis, wie es die Philosophen nennen, geht derweil im Kopf oder wo auch immer weiter. Bis sich irgendwann der sprachliche Ton nicht mehr kneten lässt, das heißt: nicht mehr verändert werden will. Weil er sich selbst für formvollendet hält. Glaub es ihm einfach. Oder wirf das Ganze zurück in die große Tonne mit dem noch gestaltlosen Ausgangsmaterial, das man das Deutsche, das Englische, das Französische nennt. Und fang noch einmal von vorne an.
15. Mai 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Man muss kein Holzbildhauer oder Antiquitätenhändler sein, um sich für eine Geschichte zu interessieren, in der eine hölzerne Statue vom Himmel fällt oder schon gefallen ist. Solches soll der Fall gewesen sein auf der Krim, damals noch Tauris genannt. Der literarhistorisch reale Kontext des mythisch-fiktiven Ereignisses ist die im fünften vorchristlichen Jahrhundert entstandene Tragödie „Iphigenie bei den Taurern“ des zu seiner Zeit mit Literaturpreisen überhäuften Dichters Euripides.
Rache-Morde und zunächst kein Ende. Agamemnon opfert aus, wenn man so will, meteorologischen Gründen in Aulis seine Tochter Iphigenie, weshalb ihn seine Gattin Klytaimnestra, als er zehn Jahre später aus dem Trojanischen Krieg heimkehrt, mit dem Beil erschlägt. Klytaimnestra wird dafür ihrerseits von ihrem Sohn Orestes mit dem selben Schwert getötet, mit dem Orest kurz zuvor Klytaimnestras Liebhaber Aigisthos den Kopf abgeschlagen hat. Dabei hatte Orest seinen Vater Agamemnon nie wirklich kennengelernt. Als er geboren wurde, kämpfte sein Erzeuger schon seit ein paar Wochen oder Monaten in Kleinasien, um die Herausgabe seiner Schwägerin Helena zu erzwingen. Und in den wenigen Stunden, die zwischen der Heimkehr Agamemnons und seiner Ermordung durch Klytaimnestra lagen, wird für den Aufbau einer verbindlichen Vater-Sohn-Beziehung kaum genügend Zeit gewesen sein.
Tu‘ es nicht, hatte Pylades seinen Freund Orest beschworen. Du musst es tun und du wirst es tun, hatte dagegen das Orakel in Delphi apodiktisch verkündet. Was blieb Orestes da anderes übrig, als zur Tat zu schreiten und zum Schwert zu greifen, zumal das Orakel nur das bestätigt hatte, was ihm auch von seiner Schwester Elektra mehr be- als empfohlen worden war. Aber kaum hatte Orest seine Mutter ins Jenseits befördert, fuhren von dort her kommend die Erinnyen in ihn ein und der Mutter-Mörder wurde die Rache-Furien fürs erste nicht wieder los. Erst als er zusammen mit Pylades die eingangs erwähnte Holzfigur, übrigens eine Darstellung der Göttin Artemis, nach Athen ent- und überführt hatte, entspannte sich die Lage nachhaltig.
Um alle Aspekte dieser komplexen Tragödie, die Züge einer schaurigen Rache-Komödie nicht ganz verhehlen kann, gebührend zu würdigen, müsste natürlich zumindest noch erwähnt werden, dass in Tauris die tot geglaubte Iphigenie ironischerweise als opferwütige Artemis-Priesterin tätig war. Die Göttin hatte vor Jahr und Tag auf Iphigeniens Schlachtung im letzten Moment verzichtet und sie von Aulis nach Tauris teleportiert. Hätte der Rache-Reigen im Sinne des Vendetta-Gedankens seinen Sinn behalten sollen, hätte Orestes dort auf jeden und jedes treffen dürfen, nur nicht auf Iphigenie. In Tauris schloss sich ein Kreis, der sich nicht hätte schließen dürfen, falls die Logik der Rache nicht allen Orakel-Sprüchen zum Trotz einer peinlichen Befragung durch die unberechenbare Wirklichkeit hätte unterzogen werden sollen – hätte, hätte, Totschlag-Kette. Aber das nur nebenbei.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 32
Weitere Leseproben hier
8. Mai 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Sie hatten sich in Aulis versammelt und nun warteten sie auf Wind. Denn ohne Wind keine Überfahrt nach Kleinasien; um Helena zu befreien, wie es offiziell hieß. Doch kommt man der Wahrheit möglicherweise ein gutes Stück näher, wenn man sagt: um Menelaos‘ davongelaufene Frau zurückzuholen, denn so ganz unfreiwillig war die schönste Frau der Mythen-Welt ihrem Prinzen, dem als Entführer getarnten Trojaner Paris, wohl nicht in die Fremde gefolgt.
Wer sich mit Google Street View durch Aulis und Umgebung klickt, bekommt eine Ahnung davon, wie das gewesen sein könnte. Die hochgerüsteten und zunächst auch noch mittelhoch motivierten Kämpfer waren gekommen, um den düpierten Menelaos zu rehabilitieren, und nicht um heldenhaft der Hitze und der Langeweile zu trotzen. Noch drei, vier Tage Flaute und die ersten wären wieder nach Hause gefahren. Allen voran wahrscheinlich Odysseus, der sich auf das trojanische Abenteuer ohnehin nur widerstrebend eingelassen hatte. Als seine zukünftigen Kampfgefährten kamen, um ihn abzuholen, wollte er sie glauben machen, er habe nicht mehr alle Amphoren in der Speisekammer und war mit Ochs und Esel vor dem Pflug, dabei Salzkörner säend, durch den Sand gestolpert. Doch wurde der dann doch noch nicht ganz so Listenreiche von Palamedes umstandslos als wortbrüchiger Drückeberger enttarnt und, wenn schon nicht mit gezogenem Schwert, so doch mit geschwungener Ethos-Keule zum Kriegsdienst überredet.
Was also tun? Agamemnon, bei dem die oberste Heeres- und Marineleitung lag, sah nur noch einen Ausweg – es musste jetzt schon Blut fließen, und zwar Menschenblut. Die in Aulis verehrte Göttin war Artemis; ihr wollte Agamemnon, da zeigte er sich großzügig, seine Tochter Iphigenie im Tausch gegen eine frische Brise anbieten. In der vom Militär-Seher Kalchas verbreiteten Version des Deals hieß es, Agamemnon habe beim Jagen mehr oder weniger aus Versehen einen Hirsch der Artemis erwischt und die habe dann in Absprache mit Poseidon ein Segelverbot erlassen, daher die Windstille. Seefahrt werde es erst wieder geben, wenn Agamemnon ihr seine Tochter Iphigenie als Opfer darbringe. Was bleibe Agamemnon, so Kalchas, also anderes übrig, als der Göttin um des lieben Krieges willen den Gefallen zu tun. Punkt, kein Fragezeichen.
Das Menschenopfer verfehlte seine vermeintliche Wirkung nicht. Kaum war das Mädchen tot, erhob sich ein leichter Westwind. Einige sagten später hinter vorgehaltener Hand, der habe schon zu wehen begonnen, als der Priester noch das Messer wetzte, das er dann an Iphigeniens Kehle setzte.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 31
Weitere Leseproben hier
6. Mai 2025 | Passionsspiele
Man nenne mich einen Manieristen oder Formfetischisten, aber es gefällt mir gut, wenn eine meiner Figuren, in diesem Fall ist es der Adventisten-Prediger Manfred Haag, „unter Nutzung der Friedrichsbrücke den Neckar überquert“.
Eher zuerst als zuletzt sind es solche stilistischen Kleinigkeiten, die von kaum einem Leser oder, kaumer noch, von einer der inhaltsfixierten Leserinnen (ich bitte um Widerspruch) bemerkt werden werden, welche mich davon abhalten, ein Unternehmen abzubrechen, das am Ende gegen so ziemlich alle Regeln des zeitgemäßen Schreibens verstoßen haben wird.