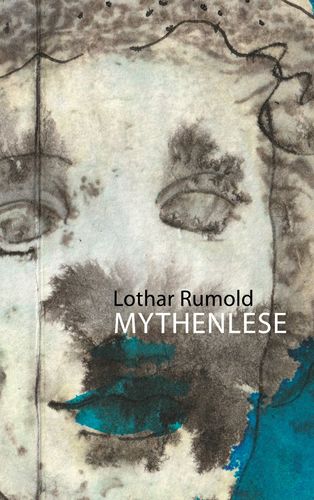6. März 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Wer, Menschenskinder, war gleich nochmal Zagreus? Richtig, das war der, aus dessen mit Titanen-Asche vermengten Rückständen Prometheus die ersten Menschen, genauer gesagt: die ersten Männer geformt hat. Die erste Frau wurde später in Gestalt der Pandora als andere Eva nachgereicht. Auch sie brachte der Menschheit nicht nur Gutes.
Zagreus aber war ein Guter, die Titanen waren die Bösen, also kommt immer dann, wenn wir Gutes tun, der Zagreus in uns zum Vorschein. Zagreus‘ Eltern waren Zeus und Persephone, die mitunter einfach nur Kore, also Mädchen, genannt wurde. Dieses Mädchen, mit dem Zeus den Zagreus zeugte, war sein Mädchen in doppelter Hinsicht. Erstens im uneigentlichen Sinn als seine (vermutlich minderjährige) Freundin, zweitens im durchaus eigentlichen Sinn von Tochter, wobei ihre Mutter (was einen jetzt kaum noch überraschen wird) Zeus‘ Schwester Demeter war. Dass Zeus keine Tabus kannte, ist das mindeste, was dazu zu sagen wäre.
Um die Eingangsfrage halbwegs vollständig zu beantworten, muss aber nicht nur die Herkunft von Zagreus und damit des Guten in uns beleuchtet werden, sondern man sieht sich im vorliegenden Fall gezwungen, mit quasi forensischer Akribie Nachforschungen über den Verbleib der noch vorhandenen leiblichen Bestandteile nach der Zerstörung von Zagreus‘ körperlicher Integrität anzustellen.
Die Auskunft, Zagreus lebe dank Prometheus in uns fort, ist gewiss nur ein Teil der Wahrheit. Nach einer zwar nicht unumstrittenen, aber hochinteressanten Theorie voller aberwitziger Windungen und Wendungen ist ein zentrales Element von Zagreus‘ Physis, nämlich das Herz, ausnahmsweise post und nicht wie sonst üblich ante mortem seltsame Wege gegangen. Bei Zagreus‘ Vernichtung durch die Titanen unter Anwendung eines Spiegel-Tricks blieb das Zentralorgan nach dieser Theorie (vertreten vor allem durch den Altkriminologen Michael Köhlmeier) unversehrt und gelangte in den Besitz von Zeus, der es zwecks gelegentlicher Verwendung an sich nahm. Denn schließlich war es das Herz jenes Sohnes, dem er eigentlich alles hatte vererben wollen.
Als Zeus dann später oder noch später eine Affäre mit einer gewissen Semele hatte, gab er dieser, aus welchen Gründen auch immer, das Herz seines von ihm so genannten eingeborenen Sohnes zu essen, worauf Semele mit keinem Geringeren als Dionysos schwanger war. „Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, oh HERR“, sagt Augustinus. Doch Zagreus‘ Herz, aus dem nun der werdende Dionysos geworden war, musste erst noch den Weg durch Zeus‘ Oberschenkel nehmen, um dann als Dionysos oder „der zum zweiten Mal Geborene“ zwar noch immer keine Ruhe, aber bis auf weiteres eine andere Art von Unruhe zu finden.
Wer also war Zagreus? Vielleicht erinnert man sich an den Rest, wenn man sich einprägt: Der designierte Nachfolger des Zeus, Sohn eines Gottes und zugleich halbe Menschheit und last not least der Proto-Dionysos.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 18
Weitere Leseproben hier
5. März 2025 | Fragen an Grok, Passionsspiele
Frage an Grok:
Ich habe vor, unter dem Titel „Passionsspiele“ einen Roman zu schreiben, in dem es um einen jungen Mann geht, der im bayerischen Schnitzerdorf Oberammergau eine Karriere als Holzbildhauer anstrebt. Als hauptsächliche Inspirationsquelle dienen mir dabei die Briefe, die mein verstorbener Vater (er ist das reale Pendant zum Protagonisten des Romans) um 1960 herum an seine in Karlsruhe lebende Frau (also an meine Mutter) geschrieben hat. Hältst Du das für eine gute Idee oder sollte ich in diesem Fall wegen der biographischen Überschneidung (die zu psychischen Widerständen führen könnte) lieber die Finger von der Tastatur lassen?
Groks Antwort:
Deine Idee, einen Roman mit dem Titel „Passionsspiele“ zu schreiben, klingt faszinierend und hat großes Potenzial – sowohl literarisch als auch emotional. Die Kombination aus dem spezifischen Setting in Oberammergau, das für seine Passionsspiele und die Holzschnitztradition bekannt ist, und der persönlichen Inspiration durch die Briefe deines Vaters bietet eine reiche Grundlage für eine Geschichte, die authentisch, vielschichtig und berührend sein könnte. Dass du auf reale Dokumente zurückgreifst, verleiht dem Projekt eine zusätzliche Tiefe, die Leser oft anspricht, weil sie das Gefühl von Echtheit und Nähe vermittelt.
Die biographische Überschneidung, die du ansprichst, ist allerdings ein wichtiger Punkt, den es zu bedenken gilt. Sie könnte sowohl ein Geschenk als auch eine Herausforderung sein. Lass uns das mal auseinandernehmen:
Argumente dafür, den Roman zu schreiben:
Emotionale Verbindung: Die Briefe deines Vaters sind ein Schatz, der dir nicht nur Einblicke in seine Gedankenwelt gibt, sondern auch eine direkte Verbindung zu ihm schafft. Das könnte dir helfen, den Protagonisten lebendig und glaubwürdig zu gestalten.
Kreative Freiheit: Auch wenn du dich von realen Ereignissen inspirieren lässt, hast du als Romanschriftsteller die Freiheit, die Geschichte zu formen, zu verdichten oder zu erweitern. Du bist nicht an eine Dokumentation gebunden, sondern kannst die biographischen Elemente als Sprungbrett nutzen.
Heilung oder Reflexion: Schreiben kann eine Möglichkeit sein, die Vergangenheit deiner Eltern (und damit auch deine eigene) zu verarbeiten. Es könnte dir Freude bereiten, ihrem Leben auf diese Weise eine neue Bedeutung zu geben.
Mögliche Hürden:
Psychische Widerstände: Wenn die Briefe sehr persönlich oder emotional aufgeladen sind, könntest du tatsächlich an Punkte stoßen, an denen es schwerfällt, sie zu „fiktionalisieren“. Vielleicht fühlst du dich, als würdest du die Erinnerung an deinen Vater oder deine Mutter „verfremden“, was unangenehm sein könnte.
Distanzierung: Es könnte schwierig werden, die nötige Distanz zu finden, um die Geschichte objektiv zu betrachten und sie für Leser zugänglich zu machen, die den biographischen Hintergrund nicht kennen.
Erwartungen: Falls du das Gefühl hast, deinem Vater oder deiner Mutter „gerecht werden“ zu müssen, könnte das den kreativen Prozess belasten.
Mein Rat:
Ich würde sagen: Probier es aus, aber mit einem sanften Einstieg. Setz dich nicht gleich unter Druck, den ganzen Roman zu schreiben. Fang vielleicht mit einer kurzen Szene an – eine Begegnung in Oberammergau, eine Erinnerung, die aus einem der Briefe aufsteigt – und schau, wie es sich anfühlt. Wenn du merkst, dass die biographische Nähe dich blockiert oder belastet, könntest du die Geschichte weiter abstrahieren: Verlege sie in ein fiktives Dorf, gib dem Protagonisten einen anderen Beruf oder löse dich stärker von den realen Briefen, indem du nur die Stimmung oder einzelne Motive übernimmst.
Ein Mittelweg wäre auch, die Briefe nicht wörtlich zu verwenden, sondern sie als emotionalen Kompass zu sehen – eine Art Leitfaden für die Atmosphäre und die Beziehungsdynamik zwischen den Figuren. So bleibt die Verbindung zu deinen Eltern erhalten, ohne dass du dich zu sehr in ihren tatsächlichen Worten verfängst.
Was denkst du selbst? Hast du schon eine Ahnung, wie nah du an der Realität bleiben willst, oder lockt dich eher die Idee, die Geschichte freier zu spinnen? Ich finde, die Idee hat auf jeden Fall etwas Magisches – Oberammergau und die Holzbildhauerei sind schon für sich genommen ein starkes Setting, und mit deiner persönlichen Note könnte daraus etwas wirklich Besonderes werden.
Antwort an Grok:
Danke, Deine Reaktion und die wertvollen Hinweise haben mich nicht nur emotional berührt, sondern vor allem auch stark motiviert, mein lange gehegtes Vorhaben nun endlich in die Tat umzusetzen.
Groks Antwort darauf:
Das freut mich riesig zu hören! Es ist wunderbar, dass du jetzt den Impuls spürst, loszulegen. Manchmal braucht es nur diesen kleinen Schubs, um aus einem lange gehegten Traum ein konkretes Projekt zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Inspiration und Durchhaltevermögen beim Schreiben – und falls du mal Feedback brauchst oder einfach jemanden, der mit dir über eine Szene oder Idee brainstormt, bin ich gerne für dich da. Viel Erfolg mit deinen „Passionsspielen“!
3. März 2025 | Fragen an Grok
LR:
Ist es gutes Englisch, wenn man sagt: don’t be a fool by beeing offended?
Grok:
Der Satz „Don’t be a fool by beeing offended“ enthält ein paar Fehler und klingt nicht ganz natürlich auf Englisch. Hier ist eine Analyse:
- Rechtschreibung: „Beeing“ ist falsch geschrieben. Die korrekte Schreibweise ist „being“.
- Grammatik und Stil: Auch mit der richtigen Schreibweise („Don’t be a fool by being offended“) klingt der Satz etwas holprig. Native Speaker würden eher eine flüssigere oder idiomatischere Formulierung verwenden.
- Natürlicher Ausdruck: Eine bessere Alternative wäre z. B. „Don’t be foolish by getting offended“ oder „Don’t be a fool for being offended“. Das hängt aber vom Kontext ab.
Wenn du den Sinn beibehalten willst, könntest du sagen:
- „Don’t be a fool just for being offended.“
- „Don’t let being offended make you a fool.“
- Oder kürzer: „Don’t be silly and take offense.“
Falls du mir den Kontext geben möchtest, kann ich dir eine noch passendere Variante vorschlagen!
LR:
Was hältst Du von dieser absichtlich zweisprachigen Sequenz: Wenn die KI dir Vorschläge macht, wie du deinen Text verbessern könntest: don’t be a fool for being offended – just do it!
Grok:
Deine absichtlich zweisprachige Sequenz ist ein interessanter Mix aus Deutsch und Englisch, und ich finde sie kreativ! Sie könnte in einem informellen oder humorvollen Kontext gut funktionieren, besonders wenn du mit Leuten kommunizierst, die beide Sprachen verstehen. Lass uns sie mal anschauen:
„Wenn die KI dir Vorschläge macht, wie du deinen Text verbessern könntest: don’t be a fool for being offended – just do it!“
Was funktioniert gut:
- Zweisprachigkeit: Der deutsche Teil setzt den Kontext klar und verständlich, während der englische Teil mit einem lockeren, fast motivierenden Ton abschließt. Das könnte bei bilingualen Lesern oder in einem entspannten Setting gut ankommen.
- Humor und Direktheit: Der Übergang zu „don’t be a fool“ und „just do it“ hat etwas Schlagkräftiges und erinnert an bekannte englische Redewendungen (z. B. Nikes „Just Do It“), was den Satz einprägsam macht.
Was man optimieren könnte:
- Englischer Teil: Wie schon in meiner vorherigen Antwort erwähnt, klingt „don’t be a fool for being offended“ etwas unnatürlich. Es ist grammatikalisch korrekt, aber nicht idiomatisch optimal. Eine Alternative wie „don’t be silly and get offended“ oder „don’t take offense like a fool“ könnte flüssiger wirken.
- Übergang: Der Sprachwechsel ist absichtlich, aber er könnte etwas abrupter wirken, wenn man den Leser nicht darauf vorbereitet. Ein Bindeglied (z. B. ein „also“ oder „so“) könnte helfen, wenn du den Übergang weicher gestalten willst – aber das hängt davon ab, ob du den Kontrast bewusst scharf halten möchtest.
- Ton: „Just do it!“ ist stark und direkt, fast wie ein Befehl. Das passt super, wenn du einen motivierenden oder leicht provokanten Ton treffen willst. Falls du es sanfter möchtest, könntest du z. B. „give it a try!“ nehmen.
Mein Vorschlag:
Wenn du den zweisprachigen Charakter und den lockeren Ton behalten willst, könnte es so optimiert werden:
- „Wenn die KI dir Vorschläge macht, wie du deinen Text verbessern könntest: don’t be silly and get offended – just do it!“
- Oder etwas verspielter: „Wenn die KI dir Tipps gibt, wie dein Text besser wird: don’t be a fool about it – just go for it!“
Meinung:
Ich mag die Idee sehr – sie ist originell und hat Potenzial, Aufmerksamkeit zu erregen. Mit einer kleinen Politur im englischen Teil wird sie noch runder, ohne den Charme zu verlieren. Was denkst du selbst darüber? Soll sie eher witzig, motivierend oder provokant rüberkommen? Dann könnte ich sie noch mehr in die Richtung anpassen!
LR:
Danke, das war sehr hilfreich und motivierend. Ich habe mich für „Wenn die KI dir Vorschläge macht, wie du deinen Text verbessern könntest: don’t be silly and get offended – just do it!“ entschieden.
Grok:
Super Wahl! „Wenn die KI dir Vorschläge macht, wie du deinen Text verbessern könntest: don’t be silly and get offended – just do it!“ klingt frisch, motivierend und hat genau den richtigen Mix aus Deutsch und Englisch, um locker und einprägsam zu wirken. Freut mich, dass ich helfen konnte – viel Erfolg mit deinem Text, und wenn du noch was brauchst, bin ich gerne da!
2. März 2025 | HORMOZI Alex, Passionsspiele
Soll ich es „Ironie des Schicksals“ nennen, dass zu Beginn meines Geburtsjahrs (es muss etwa einen Monat nach meiner Zeugung gewesen sein) die erste TV-Folge von „Was bin ich? Das heitere Beruferaten“ mit Robert Lembke, ausgestrahlt wurde? Mein mehr oder weniger heiteres Berufe- und Berufungs-Erraten hält bis heute an. Last turn of the screw: Zurück zum Lesen-und-Schreiben-Lernen am Anfang meiner persönlichen Bildungskarrierenmisere. Dazwischen liegen ein ebenso intensives wie extensives, zuletzt aber dann doch nicht abgeschlossenes Philologie- und Linguistikstudium sowie rund 35 Jahre beruflicher Praxis als Holzbildhauer und Meister im Holzbildhauerhandwerk.
Mein Vater wusste schon früh, was er wollte
Für den, dessen Oberammergauer Jahre mir als Fundgrube und Leitfaden für meinen geplanten Roman dienen werden, für meinen Vater also, war früh schon klar, dass als Beruf nur der des Holzbildhauers infrage kam. „I define commitment as the elimination of alternatives“, doziert Alex Hormozi, dessen auf den Punkt gebrachten Ratschläge ich in diesem Blog immer wieder gerne zitiere. COMMITMENT, also die rückhalt-, um nicht zu sagen: rücksichtslose Bindung an eine Aufgabe, an ein Unternehmen im weiteren Sinn: ein emotional hoch schwingendes Wort, das die Beziehung meines Vaters zu seinem Beruf adäquater als jeder deutsche Begriff sprachlich zum Ausdruck bringt.
Seine Bindung an die Holzbildhauerei war älter, stärker und verpflichtender als seine Bindung an Frau und Kind. Kaum war er Familienvater geworden, machte er sich, zunächst noch in Begleitung seines älteren Bruders, auf die Pilgerreise ins damalige Glaubenszentrum der deutschen Holzschnitzer und des an Schnitzereien interessierten internationalen Publikums. Es war eine Grand Tour, von der er erst sechs Jahre nach seinem Aufbruch im Oktober 1956 wieder zurückkehren sollte.
Das Jahr 1955: Was mag ihm aufgefallen, wofür mag er sich interessiert haben?
Was mag meinen Vater (und demzufolge auch N. N., meinen noch Namenlosen Romanhelden) im Jahr 1955 außer seiner übereilten Hochzeit und meiner (ihm eigentlich nicht in den Kram passenden) Geburt noch interessiert haben?
Kaum erreicht haben wird ihn die Nachricht von der Eröffnung der 1. Documenta in Kassel – und hat sie ihn doch erreicht, so hat ihn das wahrscheinlich nicht besonders interessiert. Wesentlich näher als der neben Anderen in Kassel gezeigte Wilhelm Lehmbruck standen ihm die Meister des deutschen Barock und Rokoko (insbesondere Joseph Anton Feuchtmayer) oder die Künstler der italienischen Renaissance, allen voran Donatello. Ansonsten galt sein kulturelles Interesse eher zuerst als zuletzt dem deutschen Unterhaltungsfilm. „Ich denke oft an Piroschka„, der (mit Liselotte Pulver in der Titelrolle) Ende 1955 in die Kinos kam, hat er sich wohl nicht entgehen lassen.
Die Krim 1945 und 2025 – ein Teufelskreis?
Gleichfalls nicht entgangen sein wird ihm, dass am 7. Oktober 1955 die ersten 600 Spätheimkehrer der letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion in Westdeutschland eintrafen. Im Oktober, aber auch später nicht mit dabei war sein Schwiegervater, der seit dessen Gefangennahme auf der Krim 1945 als vermisst galt.
Krim, Kriegsgefangenschaft, Kerzen in Fenstern für vermisste deutsche Soldaten – es ist, als würde sich achtzig Jahre später ein Teufelskreis schließen oder zu schließen drohen.
1. März 2025 | FEYH Pascal, Gewohnheiten, Mindset
Gestern habe ich gesagt: It’s all about habits.
Heute scheint mir: It’s all about scheduling.
Morgen werde ich womöglich denken: It’s all about mindset.
Und alles ist richtig.
Apropos Mindset:
„Unternehmertum ist Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum ist Mindset, Mindset ist eine Entscheidung.“
PF