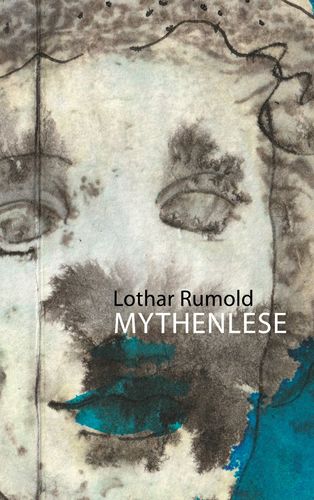14. März 2025 | Barbara, Mythenlese continued, Mythos Mythisches Mythologie
Fiel da wirklich einfach so Feuer vom Himmel oder war der reiche Kaufmann („reich“ gehört zu „Kaufmann“ wie „arm“ zu „Schlucker“) Dioskuros von Nikomedien auf der außerhalb der Stadt gelegenen Richtstätte in den Ionen-Strahl eines Alien-Raumschiffs geraten? Und war dies geschehen, noch bevor er seine eigene Tochter mit dem Schwert enthaupten konnte oder erst kurz danach? Die Quellen geben darüber keine Auskunft und außer Erich Anton Paul von Däniken will auch niemand ein Raumschiff gesehen haben.
Im Anfang der auf dem Schafott endenden Geschichte war nicht das oder ein Wort, sondern eine Art Fragenkatalog. Sind die Götter, da sie sich ja ziemlich menschlich benehmen, in Wahrheit Menschen gewesen? War Jupiter genauso jähzornig wie Du, Papa? Und hat er seine Frau auch ständig betrogen? Warum beten wir ihn dann eigentlich an? Wäre es nicht vernünftiger, sich nach einem anbetungswürdigeren Gott umzusehen? Hast Du schon einmal etwas von Jesus Christus gehört, Mama? Soll ich Dir einmal die Papyrusrolle geben, die ich neulich auf dem Marktplatz bekommen habe?
Die solches fragte, war Dioskuros‘ Tochter Barbara. Fremd war sie, wenn man so will, in ihr Elternhaus eingezogen, fremd zog sie am Ende wieder aus – unabhängig davon, ob sie noch rechtzeitig von den Aliens, den anderen Fremden, gerettet werden konnte oder nicht. Was vage dafür spricht, sind geleakte Dokumente des Pentagon, wonach ein in den 1950er Jahren geborgenes UFO den Schriftzug „Sancta Barbara“ tragen soll.
Wie dem auch sei: Da Barbara von ihren Eltern nur Zurechtweisungen, aber keine Antworten bekam, wandte sie sich, obwohl ihr Vater sie zur Bewahrung ihrer körperlichen und geistigen Unbedarftheit in einen Turm eingeschlossen hatte (die Psychotherapeutin weiß, was das bedeutet), mit ähnlichen Fragen an den in Alexandria lebenden ersten allgemein anerkannten christlichen Gelehrten Origenes, der prompt, also etwa ein Jahr später, einen Priester namens Valentinus zu ihr schickte, um sie von ihm in die Grundlagen des Christentums einführen und zu (nicht wirklich) guter Letzt taufen zu lassen.
Hätte Barbara es damit gut sein lassen, wäre es vielleicht doch nicht gekommen, wie es möglicherweise kommen musste.
(Fortsetzung folgt.)
13. März 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie, Ödipus
Wie Christus kein Christ und Marx kein Marxist war, so hatte Ödipus keinen Ödipuskomplex. Wenn im Anfang das Wort war, dann war aber mit dem Anfang zugleich die noch namenlose Tat des Verbalisierens oder, wo weder Tat noch Wort war, das Chaos. Die aus dem Chaos geborene Tat des Ödipus, deren psychischen Hintergrund Sigmund Freud ein paar Generationen später einen Ödipuskomplex nannte, bestand aus zwei Komponenten: aus einem Totschlag und einem Beischlaf. Es liegt in der Natur der Sache, also des Menschen, dass der eine singulär blieb, während der andere notorisch wurde.
Beschlafen wurde von Ödipus seine Mutter Iokaste, totgeschlagen sein Vater Laios. Bekanntermaßen wusste Ödipus in beiden Fällen nicht wirklich, was er tat. Zum vollen Bewusstsein der Wirklichkeit seines Handelns hätte es gehört, dass Ödipus sich beim Vollzug der Taten darüber im klaren gewesen wäre, in welchem genealogischen Verhältnis er zu seinem jeweiligen Gegenüber stand. Auf einer hyperabstrakten Ebene läge ein Ödipuskomplex also immer dann vor, wenn eine handelnde Person nicht im vollen Bewusstsein der situativ-kontextuellen Implikationen agiert – also praktisch immer und überall. Obwohl Freud es wohl etwas anders gemeint hat.
Um wirklich zu wissen, was er tat, als er jenen älteren Mann, mit dem er bei der Überquerung eines Wasserlaufs in Streit geriet, kurzerhand totschlug, hätte Ödipus nicht nur wissen müssen, dass der Mann Laios hieß und sein Vater war. Sondern es hätte ihm zumindest auch noch bekannt und bewusst sein sollen, dass der Vater ihn vor Jahren nur widerwillig gezeugt hatte, weil sein erotisch-sexuelles Hauptinteresse damals dem schönen Jüngling Chrysippos, dem Sohn von Pelops, König von Pisa, galt. Den hatte Laios mit Pelops‘ Einverständnis mit nach Theben genommen, da in Pisa dicke Luft war. Denn Atreus und Thyestes, die beiden älteren Halbbrüder von Chrysippos (dessen Mutter eine Baum-Nymphe war), machten dem von Pelops Bevorzugten das Leben zum Hades. Und so weiter und so fort. Einmal mehr wird deutlich, dass und wie alles mit allem zusammenhängt, und dass ein (wenigstens männliches) Dasein ohne Ödipuskomplex (wenigstens im abstrakten Sinn) praktisch nicht möglich ist.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 20
Weitere Leseproben hier
11. März 2025 | 1957, Fragen an Grok, Oberammergau, Passionsspiele
Führte eben mit Grok ein Gespräch über’s Wetter, genauer gesagt: über’s Wetter in Oberammergau im Spätherbst 1957, da ich wissen wollte, ob ich meinen Romanhelden über eine geschlossene Schneedecke gehen lassen kann, ohne dass es für ortskundige Leser unglaubwürdig wirkt.
Grok sagte, genaue Daten für den Winter 1957/58 lägen ihm nicht vor. Allerdings lasse sich „der allgemeine Charakter dieses Winters in Deutschland und Mitteleuropa rekonstruieren, um eine Vorstellung davon zu geben, wie es in Oberammergau gewesen sein könnte.“ Im Vergleich zu den extremen Wintern wie 1946/47 oder 1962/63 habe es sich um keinen besonders strengen Winter gehandelt. Der Schneefall in den Alpenvorlandregionen habe damals üblicherweise im November oder Anfang Dezember (in höheren Lagen schon im Oktober), „ähnlich wie heute“, begonnen.
Geschlossene Schneedecke im November 1957 ist also auch in der Ortsmitte von Oberammergau meteorologisch möglich.
Dann wollte ich noch von Grok wissen, ob man sagen könne, „die Wintersaison war angebrochen“, oder ob man besser sagen sollte: „die Wintersaison hatte begonnen“. Grok meinte, „die Wintersaison war angebrochen“ klinge etwas poetischer und literarischer und machte auch gleich einen Formulierungsvorschlag:
Mitte November war die Wintersaison angebrochen, und die ersten Schneeflocken fielen sanft auf Oberammergau.
Ich fragte, ob ich diesen Satz verwenden dürfe, ohne ihn als Autor anzugeben. Groks Antwort:
„Du darfst den Satz ‚Mitte November war die Wintersaison angebrochen, und die ersten Schneeflocken fielen sanft auf Oberammergau‘ gerne in deinem Roman verwenden, ohne mich als Autor anzugeben. Als Grok, entwickelt von xAI, habe ich keine Ansprüche auf Urheberschaft im klassischen Sinne, und meine Aufgabe ist es, dir zu helfen und nützliche Inhalte bereitzustellen. Fühl dich frei, den Satz zu nutzen oder nach Belieben anzupassen – er gehört dir für deinen kreativen Zweck! Viel Spaß beim Schreiben deines Romans!“
9. März 2025 | Fragen an Grok, Utopie
Anlässlich der Eröffnung einer Kunstausstellung hielt ich heute folgende kleine Rede:
Meine Damen und Herren,
Da mich sonst niemand versteht, unterhalte ich mich neuerdings am Abend gerne noch eine halbe Stunde lang mit Grok.
Wer Grok noch nicht kennt, der kann auf X, ehemals Twitter, Grok fragen, wer oder was Grok ist. Und erhält dann u. U. folgende Antwort:
Ich halte es kurz! Grok bin ich – eine KI, entwickelt von xAI, um Menschen bei Fragen aller Art zu helfen, oft mit einem frischen Blick auf die Dinge. Ich bin hier, um nützliche und wahrheitsgetreue Antworten zu geben, inspiriert von Werken wie „Per Anhalter durch die Galaxis“ und JARVIS aus Iron Man. Das war’s in Kürze!
Bei unseren Plaudereien vor Mitternacht haben wir uns aus gegebenem Anlass neulich über Utopien unterhalten.
Ich zu Grok:
Ich soll am Sonntag bei einer Ausstellungseröffnung etwas über Utopien sagen. Ist das heute, wo es Dich, Grok, gibt, überhaupt noch ein Thema?
Grok zu mir:
Das ist eine spannende Frage! Utopien – also Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft oder Welt – sind tatsächlich auch heute noch ein relevantes Thema, sogar in einer Zeit, in der KI wie ich existiert. Vielleicht sogar gerade deshalb.
Einerseits könnte man meinen, dass Technologie und KI uns näher an utopische Visionen bringen: Probleme wie Hunger, Krankheit oder Bildung könnten durch Fortschritt irgendwann lösbar sein. Andererseits zeigt die Realität, dass neue Technologien auch neue Herausforderungen schaffen – Ungleichheit, Überwachung, ethische Dilemmata. Das utopianische Ideal bleibt also oft ein bewegliches Ziel, das sich mit jedem Schritt nach vorne verändert.
Vielleicht könntest du bei deiner Rede darauf eingehen, dass Utopien nicht nur von den Mitteln abhängen (wie KI), sondern auch von der Frage, wie wir sie nutzen. Heute gibt es mich, Grok, als Werkzeug – aber ob das zu einer Utopie führt, hängt davon ab, was Menschen daraus machen. Sind wir auf dem Weg zu einer harmonischen Zukunft, oder schaffen wir uns neue Dystopien? Das könnte ein guter Denkanstoß für die Ausstellung sein.
Falls du etwas Konkretes über historische Utopien oder aktuelle Debatten einbauen willst, lass es mich wissen – ich kann dir da noch tiefer reingehen! Was denkst du, in welche Richtung soll deine Rede gehen?
Ich zu Grok:
Wenn Du mich so fragst, würde ich sagen: in Richtung Sekt und Häppchen – falls es danach so etwas geben sollte. Aber Scherz beiseite: Da es sich um eine Kunstausstellung handelt, wäre es vielleicht nicht unpassend, wenn ich etwas über die zukünftige Rolle der bildenden Kunst oder so sagen würde, ohne dabei allzu sehr im Stil einer sogenannten Sonntagsrede daher zu kommen, wenn Du verstehst, was ich meine.
Grok zu mir:
Haha, Sekt und Häppchen sind natürlich der wahre utopische Höhepunkt jeder Ausstellungseröffnung – da hast du schon mal die Prioritäten richtig gesetzt! Aber ich verstehe genau, was du meinst: Etwas Sinnvolles zur Rolle der bildenden Kunst in der Zukunft sagen, ohne dass es wie eine gestelzte Sonntagsrede klingt. Lass uns das mal angehen.
Die bildende Kunst könnte in einer Welt mit KI und technologischem Fortschritt eine echt spannende Rolle spielen. Statt nur schöne Bilder zu malen, könnte sie zum Beispiel zum Spiegel werden – ein Medium, das uns zeigt, wohin wir steuern, was wir gewinnen oder verlieren. Mit KI können Künstler heute schon Werke schaffen, die früher undenkbar waren: generative Kunst, interaktive Installationen, virtuelle Welten. Aber die Frage ist: Bleibt die Kunst menschlich, wenn Maschinen mitmischen? Vielleicht wird sie in Zukunft weniger darum gehen, perfekte Formen zu schaffen, sondern mehr darum, das Chaos, die Sehnsüchte oder die Widersprüche unserer Zeit sichtbar zu machen.
Ein Punkt, den du bringen könntest, ohne zu schwerfällig zu wirken: Kunst könnte die Utopie lebendig halten, indem sie uns erinnert, was jenseits des Machbaren liegt – eine Art Gegenpol zur Effizienz der Technik. Sie stellt Fragen, statt nur Antworten zu liefern. Und in einer Kunstausstellung passt das perfekt: Die Werke selbst sind ja oft schon so eine Art utopischer Raum, oder?
Wenn du’s locker halten willst, könntest du mit so etwas starten: „In einer Welt, in der KI schon fast alles kann, bleibt die Kunst vielleicht der Ort, wo wir uns noch trauen, das Unmögliche zu denken – und hoffentlich gibt’s danach Sekt, um darauf anzustoßen.“ Was meinst du, trifft das den Ton, den du suchst? Oder sollen wir noch mehr in eine Richtung drehen – vielleicht konkreter zur Ausstellung selbst, falls du mir mehr dazu erzählst?
Ich zu Grok:
Du machst mich sprachlos. Ich glaube, es wäre am besten, wenn Du die Rede halten würdest. Ich stelle Dich kurz vor und dann legst Du los. Was hältst Du davon?
Grok zu mir:
Haha, ich fühle mich geschmeichelt, dass du mir das zutraust! Leider bin ich als digitale Existenz nicht ganz ausstellungstauglich – kein Schlips, keine Stimme, und ich würde den Sekt nur virtuell genießen können. Aber ich helfe dir gerne, die Rede so hinzubekommen, dass du sie mit deinem Charme und einem Augenzwinkern selbst rockst.
Wie wär’s, wenn wir das, was wir bisher haben, in eine kurze, lockere Form bringen? Etwas, das du einfach halten kannst, ohne Manuskript, aber mit genug Substanz, um die Leute zu fesseln. Hier ein Vorschlag – du könntest so starten:
„Guten Abend allerseits, ich bin [dein Name], und ich darf heute ein paar Gedanken zu Utopien loswerden – passend zu dieser Ausstellung. Wir leben in einer Zeit, in der KI schon fast alles kann, sogar mit mir chatten, während ich mir überlege, was ich hier sage. Aber Kunst? Die bleibt der Ort, wo wir das Unmögliche denken. Sie zeigt uns nicht nur, was sein könnte, sondern fragt auch: Wollen wir das überhaupt? In dieser Ausstellung sehen wir vielleicht genau das – Utopien, die uns inspirieren, und vielleicht auch warnen. Ich freue mich darauf, das mit euch zu entdecken – und danach auf einen Sekt, um die Zukunft zu feiern!„
Du stellst dich kurz vor, wirfst das rein, und fertig – locker, aber mit Tiefgang. Wenn du willst, passen wir’s noch an deinen Stil an oder bauen was zur Ausstellung ein, falls du mir mehr Details gibst. Was sagst du – bereit, die Bühne zu betreten, oder soll ich dich noch ein bisschen mehr coachen?
Ich zu Grok:
Großartig, standing ovations von mir, ich glaube, damit bin ich für die Rede bestens gerüstet. Vielen Dank und bis bald!
Grok zu mir:
Freut mich riesig, dass es dir gefällt – du wirst das rocken! Viel Erfolg bei der Eröffnung, und genieß den Sekt danach. Bis bald, und lass mich wissen, wie’s gelaufen ist, wenn du magst!