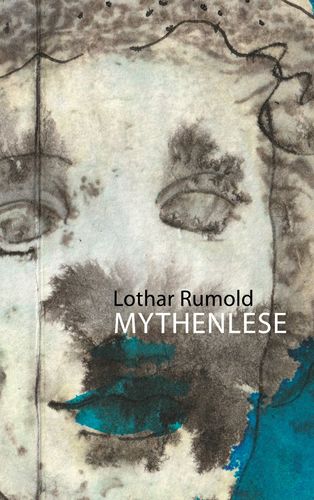23. März 2025 | Dialoge, STIFTER Adalbert
Ein Dialog in Adalbert Stifters „Der Nachsommer“ (1857), Erster Band, im Kapitel „Die Beherbergung“; Heinrich fragt eine Magd nach dem Herrn des Hauses:
„Er ist in dem Garten auf der Fütterungstenne“, sagte sie.
„Und wo ist die Fütterungstenne, wie du es nennst?“ sprach ich.
„Gleich hinter dem Hause und nicht weit von den Glashäusern“, erwiderte sie.
Und im dann folgenden Gespräch zwischen Heinrich und dem Hausherrn: „sagte er“, „erwiderte ich“, „antwortete er“, „erwiderte ich“, „antwortete er“.
20. März 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Eine Klausurfrage zum Abschluss einer Einführung in die Genealogie der griechischen Mythologie könnte beispielsweise lauten: Mit welchen möglichen familiären Hintergründen ist zu rechnen, wenn Atreus seine Nichte Pelopeia und deren Sohn Aigisthos bei sich aufnimmt, und dieser Sohn zugleich der Neffe von Atreus ist?
Antwort: Entweder ist Pelopeia die Tochter einer Schwester oder eines Bruders von Atreus, sonst wäre sie nicht seine Nichte. Wenn sie die Tochter einer Schwester ist, dann muss (Inzest-Fall Nr. 1) Atreus einen Bruder haben, der mit Pelopeia, also seiner und Atreus‘ Nichte, Aigisthos gezeugt hat, sonst wäre dieser nicht der Neffe (der Geschwister-Sohn) von Atreus. Wenn Pelopeia dagegen die Tochter eines Bruders von Atreus ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens (Inzest-Fall Nr. 2): Ein dritter Bruder hat mit seiner Nichte Pelopeia (der Tochter seines Bruders, der nicht Atreus ist) Aigisthos gezeugt. Zweitens (Inzest-Fall Nr. 3): Der Bruder, dessen Tochter Pelopeia ist, hat selbst mit dieser seiner Tochter einen Sohn (Aigisthos) gezeugt, der als sein Sohn der Neffe seines Bruders Atreus ist.
Mythologisch verbürgt ist bekanntlich Inzest-Fall Nr. 3, der gravierendste von allen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Atreus‘ Zwillingsbruder Thyestes, der Vater von Pelopeia und von deren Sohn Aigisthos, die Vergewaltigung seiner Tochter auch als vorweggenommenen Brudermord erlebt haben muss. Der zukünftige Sohn sollte, wie es vom Delphischen Orakel auf Thyestes‘ Anfrage vorhergesagt worden war, zu Ende bringen, was schon im Mutterleib als unversöhnlicher Streit zwischen den heil- und gnadenlosen Zwillingen begonnen hatte. An die zwanzig Jahre Kerkerhaft des Thyestes bei Atreus in Mykene und die vorübergehende, scheinbare Wendung der Prophezeiung in ihr Gegenteil konnten daran am Ende nichts ändern.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 21
Weitere Leseproben hier
18. März 2025 | Fragen an Grok, Mythenlese continued, Mythos Mythisches Mythologie
Gibt es, habe ich Grok aus gegebenem Anlass gefragt, in der griechischen Mythologie Geschichten, in denen Menschen in Steine verwandelt werden. Grok hat wie folgt geantwortet:
Ja, in der griechischen Mythologie gibt es tatsächlich Geschichten, in denen Menschen in Steine verwandelt werden. Eine der bekanntesten ist die Geschichte von Niobe.
Niobe war eine Königin von Theben und Mutter vieler Kinder (die genaue Zahl variiert je nach Quelle, oft werden 14 genannt: sieben Söhne und sieben Töchter). Sie war sehr stolz auf ihre Fruchtbarkeit und rühmte sich, besser als die Göttin Leto zu sein, die „nur“ zwei Kinder hatte – Apollo und Artemis. Diese Prahlerei erzürnte Leto, und sie schickte ihre göttlichen Kinder, um Niobe zu bestrafen. Apollo tötete Niobes Söhne und Artemis ihre Töchter.
Vor Kummer und Schmerz weinte Niobe ununterbrochen, bis sie schließlich von den Göttern in einen Stein verwandelt wurde. Selbst als Stein soll sie weiterhin Tränen vergossen haben, weshalb man sagt, dass der Felsen, in den sie verwandelt wurde, „weint“. In der Überlieferung wird dieser Felsen oft mit einem realen Ort in Kleinasien (heutiges Türkei) in Verbindung gebracht, dem sogenannten „weinenden Felsen“ am Berg Sipylos.
Eine weitere Geschichte, die in diese Richtung geht, ist die von Deukalion und Pyrrha, die nach der großen Flut, die Zeus sandte, um die Menschheit zu vernichten, die einzigen Überlebenden waren. Ihnen wurde von einem Orakel gesagt, sie sollten die „Knochen ihrer Mutter“ hinter sich werfen, um die Erde wieder zu bevölkern. Sie interpretierten dies als die Steine der Erde (Mutter Gaia) und warfen sie über ihre Schultern. Aus diesen Steinen entstanden neue Menschen.
Diese Erzählungen zeigen, dass die Verwandlung von Menschen in Steine oder umgekehrt in der griechischen Mythologie durchaus vorkommt und oft mit göttlicher Strafe, Trauer oder Neuschöpfung verbunden ist.
17. März 2025 | Barbara
Bei meinen weiteren Recherchen zur Heiligen Barbara stoße ich auf einen Wust an Wissbarem, um die Rede vom Wissenswerten zu vermeiden, die im Zusammenhang mit „Wust“ ohnehin ein wenig fragwürdig (Oxymoron-Verdacht) dissonieren würde. Denn wer will entscheiden, was wissenswert ist, und was nicht.
Zu den Vierzehn Nothelfern und -helferinnen, wie man heute wohl sagen muss, gehöre sie (lese ich), alle aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert stammend und als Statuetten wunderbar synoptisch und übersichtlich dargestellt in der Michaelskapelle bei Untergrombach unweit von Karlsruhe. Ihre Gebeine (die der Heiligen Barbara) liegen angeblich seit mehr als tausend Jahren auf der Insel Torcello in der Lagune von Venedig. Torcello war zur Zeit der Überführung eine für damalige Verhältnisse große Stadt mit zehn- bis zwanzigtausend Einwohnern, während 2009 nur noch 14 Menschen auf Torcello lebten. Aber ich schweife ab.
Bei Wikipedia lese ich im Zusammenhang mit dem Barbara-Gedenktag am 4. Dezember: „In den Liturgiereformen des zweiten vatikanischen Konzils (1962–1965) wurde die heilige Barbara aus dem römischen Generalkalender gestrichen, weil ihre Existenz historisch nicht gesichert ist. Wegen der großen Verehrung, die sie im Volk genoss, blieb ihr Gedenktag jedoch in einigen Regionalkalendern erhalten.“ Der Tag ist nicht mehr fern, an dem Gott aus den römisch-vatikanischen Schriften und Kalendern gestrichen wird, weil seine Existenz historisch nicht gesichert ist. Bei den evangelischen Kollegen wird dieser Tag wahrscheinlich schon ein paar Monate früher kommen. Aber ich schweife schon wieder ab.
Barbara war und ist Schutzpatronin der Bergleute, zunächst und vor allem in Sachsen, Schlesien und Böhmen, später auch im Ruhrgebiet und an der Saar. Dazu noch einmal Wikipedia: „1937 trugen im gesamten Deutschen Reich sechs Apotheken ihren Namen, gegenüber 80 Barbara-Apotheken 2013 in der Bundesrepublik Deutschland; die Mehrheit der Barbara-Apotheken steht in den (ehemaligen) Montangebieten an Ruhr und Saar.“
Aber auch Feuerwehrleute und Bundeswehr-Soldaten, sofern sie bei der Artillerie, der Flugabwehr oder der Marine Dienst tun, bitten um den Schutz der Heiligen. Alles Weitere im oben verlinkten Wikipedia-Artikel.
„Die Heilige Barbara (Teil 1/3)“
„Die Heilige Barbara (Teil 2/3)“
15. März 2025 | Barbara, Mythenlese continued, Mythos Mythisches Mythologie
Auch den Fortgang der Geschichte kenne ich nur vom Lesensagen. Sie sei dann in ein Opferbecken gestiegen und habe laut nach Johannes dem Täufer gerufen, um sich von ihm ein zweites Mal taufen zu lassen, heißt es an einer Stelle. Anderswo lese ich, die da noch unheilige Barbara habe sich ihrem Vater gegenüber als Christin geoutet, nachdem sie beim Bau eines eigens für sie errichteten Badehäuschens eigenmächtig und immer wieder auch eigenhändig dafür gesorgt hatte, dass das Bauwerk einer christlichen Kapelle aus dem noch kommenden 18. Jahrhundert ähnlicher sah als einem zeitgenössisch spätrömischen Balnearum.
Auf die Spitze hatte Barbara es dann anscheinend getrieben, als sie mit Hilfe eines ihr ergebenen Masseurs ein Götzenbild, wie sie es nannte, vom Sockel stieß und an seiner Stelle ein mit Diamanten und Smaragden aus dem väterlichen Besitz besetztes goldenes Kreuz aufstellen ließ. Der von einer Reise zurückgekehrte Vater will sie daraufhin erschlagen, aber sie entkommt „und ein Felsspalt öffnet sich, um sie zu verbergen“, wie es in „Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten“ heißt. Die Story von dem Hirten, der ihren Aufenthaltsort entdeckte und, nachdem er ihren Vater darüber informierte hatte, zu Stein wurde, wohingegen sich seine Schafe in Heuschrecken verwandelten, – diese Geschichte kommt mir ein wenig zu mythologisch inspiriert vor, auch wenn ich von Grok die Auskunft erhalte, in der griechischen Mythologie gebe es „keine direkte, bekannte Geschichte, in der Schafe explizit in Heuschrecken verwandelt werden.“ Wohl aber gebe es, was die Verwandlung von Menschen in Steine angehe, die Geschichte von Niobe und die von Deukalion und Pyrrha, die in die gleiche Richtung gehe (hier die Zusammenfassung von Grok).
Der Rest ist Martyrium. Geißelung auf Geheiß des römischen Statthalters Marcianus. Nächtliche Heilung der Wunden durch den Heiland. Wieder Schläge, dieses Mal mit Keulen, und Amputation der Brüste. Als Marcianus „sie dann entkleidet auf dem Marktplatz umhertreiben und peitschen lassen will, erscheint auf B.s Gebet ein Engel und hüllt sie in ein schneeweiß leuchtendes Gewand. Den Befehl, sie nun mit dem Schwert hinzurichten, führt der ergrimmte Vater selbst aus und wird danach durch vom Himmel fallendes Feuer getötet“, aber das sagte ich schon. Interessant, dass der Vater nach Reclams Lexikon und nach allem, was er da mitangesehen hatte, immer noch „ergrimmt“ war, und zwar wegen der Taten seiner Tochter und nicht wegen der des Marcianus.
„Die Heilige Barbara (Teil 3/3)“