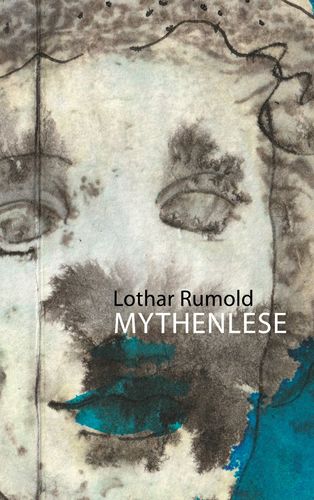19. April 2025 | Astrologie, Sternbilder, Tierkreiszeichen, Zodiak
Mit der Sonne und dem Tierkreis ist es wie mit mir und der Lebensbahn: Wandert die Sonne Monat für Monat durch die (mittlerweile nur noch gedachten, s. u.) Sternbilder am Fixsternhimmel oder kommen diese auf die Sonne zu? Gehe ich mehr oder weniger aktiv auf die Siebziger zu oder kommen sie mir ungerufen entgegen?
Man kann es auch so sehen: Auf ihrem scheinbaren täglichen Lauf um den Globus herum wird die Sonne während eines Jahres langsam aber sicher von den zwölf Tierkreiszeichen der Reihe nach überholt – zunächst von der astrologischen Idee von Widder und Stier und erst danach von deren astronomisch konkreten Realisierung.
Stichwort „Präzession der Erdachse“: Die astrologischen Sternbilder sind den astronomischen während der letzten zweitausend Jahre um ein Zeichen voraus geeilt (1° alle 71,6 Jahre), das heißt beispielsweise: wenn sich die Sonne astrologisch gedacht im Widder befindet, steht sie astronomisch oder optisch gesehen noch im Sternbild Fische, wobei zu beachten ist, dass die Größe und Position der dreizehn (13) astronomischen Sternbilder erheblich variiert, während die zwölf (12) astrologischen Zeichen mit ihren jeweils 30° als gleich groß zu denken sind.
18. April 2025 | Gott, Jesus
Um die Verbundenheit mit dem Herrn (welchem auch immer) regelmäßig zu erneuern und damit aufrechtzuerhalten, schreckte man in alttestamentarischen Zeiten offenbar nicht davor zurück, den erstgeborenen Sohn oder wenigstens eine der zahlreich vorhandenen Töchter zu opfern als wären sie ein Lamm oder ein Widder Gottes – eine Gleichung, deren reziproke Gültigkeit im Rahmen einer transzendenten Mathematik vom HERRN selbst bestätigt wurde, als er Abraham als Ersatz für seinen im letzten Moment begnadigten Sohn Isaak mit den von Thomas Mann überlieferten Worten „und hier hast du übrigens einen Widder“ einen Widder zur ersatzweisen Schlachtung zukommen ließ.
Der eben erwähnte Abraham muss mit seinem Vorbehalt gegenüber der göttlichen Anweisung, den eigenen Sohn zu opfern, eine Ausnahme gewesen sein. Allgemein war die Opferbereitschaft anscheinend ebenso groß wie weitverbreitet, so dass ein explizites Verbot von Menschenopfern nötig schien, um diesem von da an gottlosen Brauch Einhalt zu gebieten (5. Mose 18,10: „Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt“).
Warum mit Christi Opfertod zum Wohle der Menschheit einer im Judentum obsolet gewordenen Gepflogenheit die Ehre einer anderen Auferstehung zuteil wurde und bis heute zuteil wird, ist und bleibt ein Rätsel. Am wenigsten überzeugend, ja geradezu peinlich „aufgeklärt“ sind rationalisierende Erklärungen wie etwa die von Franz Alt, der meinte, letztlich nur mit diesem Selbstopfer (einer Art Suicide by Pilatus) habe Jesus die potenziellen Konvertiten unter den Juden von der Authentizität seiner Botschaft und der Gültigkeit seiner Lehre überzeugen können. Really?
Ein ins Mystisch-Transzendente spielender Versuch, das zunächst Unverständliche verständlich(er) werden zu lassen, könnte argumentieren, dass nur im Rückgriff auf scheinbar Obsoletes eine bis dahin noch nicht erreichte finale Versöhnung zwischen Gott und den Menschen (übrigens eine Versöhnung in beide Richtungen) möglich werden konnte. Dieser Rückgriff durfte nicht ein x-beliebiger sein, sondern musste die Qualität einer Tautologie der Tautologien haben, nicht ein Circulus vitiosus, sondern ein Circulus tandem liberandi war gefragt: der in Gestalt seines Sohnes Mensch gewordene Gott opfert sich SICH selbst. Wem es gelänge, den Algorithmus der darin verborgenen göttlichen Logik Programm werden zu lassen, hätte womöglich den Schlüssel zu jener anderen Singularität auf der Festplatte, die wir Parusie oder Wiederkunft Christi nennen.
17. April 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Von Theseus‘ Geburtsstadt Troizen nach Athen sind es auf dem Landweg 160 Kilometer. Für einen, der gut zu Fuß war, sollte das in einer Woche zu schaffen gewesen sein. Hätte Theseus übers Wasser gehen könne, wären es von A (also T.) nach B (also A.) kaum mehr als sechs Stunden gewesen. Wie an anderer Stelle in Ansätzen berichtet, hat der junge Held dabei fünf oder sechs mehr oder weniger menschliche Wegelagerer und ein Tier in Form einer Sau zur Strecke gebracht – „clearing the highway of assorted bandits and miscreants“ nennt das ein Internet-Lexikon zur griechischen Mythologie.
Das zu dieser gemischten oder auch schlecht sortierten („assorted“) Gesellschaft gehörige Schwein hörte auf den gar nicht so unschönen Namen Phaia, wobei, wer das oben zitierte Lexikon konsultiert, die Auskunft erhält, nicht das Schwein selbst, sondern dessen in die Jahre gekommene Halterin habe so geheißen und beide, die ältere Dame und ihr wahrscheinlich einziges Haustier, seien von Theseus mir nichts, dir nichts erschlagen worden. Träfe dies zu, wären Zweifel an der moralischen Integrität des später vergleichsweise populären Königs von Athen durchaus angebracht. Musste der Tod der Greisin als Kollateralschaden in Kauf genommen werden? Was konnte diese dafür, dass ihr wählerisches Schwein nur Menschen fraß? Oder hatte die Alte selbst es ihm beigebracht? Und, wenn ja, warum?
Wirft man allerdings einen Blick auf den Stammbaum des getöteten Tieres, wird die Berechtigung der ethisch begründeten Zweifel an Theseus’ Moral wiederum in Zweifel gezogen durch das Bild des Schreckens, das sich dem genealogisch informierten Auge darbietet.
Mütterlicherseits stammte Phaia, die Sau, möglicherweise von Chrysaor ab, der zusammen mit Pegasos dem Rumpf der durch Perseus enthaupteten Medusa entwichen war. Über Phaias Großvater Chrysaor selbst kann nichts Nachteiliges berichtet werden. Der Umstand, dass er, wie sein Name schon sagt, mit einem goldenen Schwert in der Hand zur Welt kam, spricht per se noch nicht gegen ihn. Anders sieht die Sache bei Chrysaors Tochter Echidna aus. Um wenigstens eine Ahnung davon zu vermitteln, mit wem man es zu tun bekam, wenn man es mit ihr zu tun bekommen hat, wird hier der griechische Dichter Hesiod zitiert, der in seiner Theogonie schreibt, Echidna sei „ein unsagbares Scheusal, halb schönäugiges Mädchen, halb grausige Schlange, riesig, buntgefleckt und gefräßig“ gewesen. Da findet man es dann auch nicht mehr befremdlich, dass Phaias Mutter Echidna in Phaias Fall keine Tochter geboren, sondern ein Ferkel geworfen hat.
Vollends suspekt wird einem die von Theseus erschlagene Sau, wenn man sich nach ihrem Vater Typhon erkundigt. Dass der zugleich als Vater aller Taifune bezeichnet werden kann, wird zur Nebensächlichkeit, sobald man erfährt, dass die erdige Urmutter Gaia sich mit dem höllischen Tartaros eingelassen hat, nur um ein Monster zu kreieren, das stellvertretend für sie Rache nehmen sollte an Zeus und den anderen Göttern wegen deren Unterwerfung der Titanen und Giganten. Warum letztere der Mutter aller Mütter lieber waren als ihre Enkel, die es immerhin zu Göttern gebracht hatten, wussten nicht einmal die Götter.
Allein Typhon tat, was von Anfang an seine Bestimmung gewesen war und verschreckte mit seinen zahllosen Gliedmaßen und Köpfen und seinem infernalischen Gebrüll die Götter so sehr, dass sie sich erst nach Ägypten und, dort angekommen, in die Gestalt von Tieren flüchteten.
Gott (welchem auch immer) sei Dank gelang es Zeus dann doch noch, Typhon zu besiegen und einigermaßen unschädlich zu machen, indem er ihn unter der Insel Sizilien begrub, wo Phaias Vater seither mit den Aktivitäten des Ätna in Verbindung gebracht wird. Bevor es dazu kam, muss Typhon noch Zeit gefunden haben, mit dem gefräßigen Schlangen-Weib Echidna ein nicht minder gefräßiges, aber insgesamt relativ normale Schwein zu zeugen.
Als die Sau endlich zur Strecke gebracht war, soll es in Krommyon, wo Phaia bis kurz vor Theseus‘ Eintreffen ihr Unwesen getrieben hatte, nach Schweinebraten gerochen haben, obwohl Tiere, die sich hauptsächlich oder auch nur bei sich bietender Gelegenheit von Menschen ernähren, im Sinne einer onto- und ökologisch korrekten Nahrungskette für den menschlichen Verzehr eher nicht infrage kommen. Aber wenn es in der mythologischen Antike schon nichts wirklich Ungewöhnliches war, dass man mit der eigenen Tochter oder Mutter schlief, warum sollte man dann nicht auch das Filetstück eines Schweins genießen, das ein paar Monate zuvor den Vater oder den Sohn des Nachbarn gefressen hatte.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 26
Weitere Leseproben hier
16. April 2025 | Astrologie, Merkur, Widder
Heute Morgen, falls man hier noch von Morgen sprechen darf, wurde ich pünktlich um 8:25 Uhr von Merkur erst aus dem Schlaf und damit (Aufwachen und Aufstehen sind bei mir immer eins) aus dem Bett geholt. Von den Fischen kommend wechselte Hermes, wie er auf Griechisch heißt, ins Zeichen Widder, wo die Sonne schon seit 26 Tagen präsent ist und noch 5 Tage lang bleiben wird. Der damit einhergehende Energiewechsel (wenn man nicht weiß, wie man es nennen soll, nennt man es Energie) scheint mich wachgerüttelt zu haben. Kein Wunder, denn „der Widder ist der Anfang“, wie es bei Milan Spurek heißt, „ist Initiator, Veranlasser“, ist Lebensfunke und sagt „ich bin“. So fühlte sich denn auch Merkur, kaum war er dem wässrigen Chaos der Fische entronnen, dazu veranlasst, gerade mir auf die Sprünge zu helfen. Gerade mir muss man wohl deshalb sagen, weil ich, als ein im Zeichen der Jungfrau Geborener ebenso wie die in den Zwillingen zur Welt Gekommenen, Mercurius (virginem geminique regens) gewissermaßen Untertan bin.
Um, vom Anekdotischen einmal abgesehen, sagen zu können, was es heißt, dass Merkur nun bis zum 1. Mai im Sternbild Widder bleibt, wo er heute mit Neptun zusammengetroffen ist, müsste ich zumindest Hobby-Astrologe sein, was ich (noch) nicht bin. Allgemein ist Merkur, so der 2018 verstorbene Spurek, „der Planet von Vernunft und Verständnis, von Denken, Mitteilen, Vermitteln und Weitergeben, von Klugheit, Geschicklichkeit und Intelligenz.“ Wenn er nicht schon vor Tausenden von Jahren entdeckt worden wäre, müssten wir ihn spätestens jetzt finden, zur Not auch erfinden.
13. April 2025 | AI/KI
“You’re so cute!” – “You’re pretty cute, too.”
Dialog zwischen dem TV-Moderator Jimmy Fallon und Little Sophia,
einem Roboter im Puppen-Format.
Die sensomotorische Maschine namens Cutie glaubt nicht an die Erde. Für den ersten Roboter der neuen QT-Reihe existiert dieser Ort nur in der menschlichen Einbildung. Ebensowenig glaubt Cutie (QT) daran, dass es Menschen waren, die ihn geschaffen oder zusammengebaut haben. Eine Kette gültiger logischer Schlüsse, mit anderen Worten: ein Algorithmus, hat Cutie zu der Überzeugung gebracht, dass der momentan im Zentrum der Aufmerksamkeit stehende Sonnenenergie-Konverter der Raumstation, auf der Cutie sich befindet, nicht nur für sein eigenes Dasein, sondern auch für das der Menschen in seiner Umgebung verantwortlich zu machen sei. Wenn letztere ihn von etwas anderem zu überzeugen suchten, dann nur deshalb, weil ihr gemeinsamer Schöpfer-Konverter (aus Gründen, die nur ihm bekannt sind) den Menschen ein Narrativ implantiert hat, demzufolge sie selbst es waren, die sich Roboter geschaffen haben, um mit ihrer Hilfe beispielsweise Raumstationen zu betreiben, deren angebliche Aufgabe es ist, eine sogenannte Erde mit elektrischer Energie zu versorgen. “Durch logisches Schließen kannst du beweisen, was immer du willst – je nachdem, von welchen Grundannahmen du ausgehst. Wir halten das eine, Cutie etwas ganz anderes für unabweislich gegeben.” So oder so ähnlich bringt Powell, einer der beiden menschlichen Protagonisten in Isaac Asimovs Roboter-Story “Reason”, die Sache auf den Punkt.
Die Axiome der künstlichen Intelligenz der Maschine sind bei Asimov nicht identisch mit denen der natürlichen Intelligenz ihrer Konstrukteure. Was dabei herauskommt, sind argumentativ nicht vermittelbare Parallelwelten, in denen das logische System der einen Seite von der jeweils anderen Seite für eine Art Verschwörungstheorie gehalten wird. Was sehen sie eigentlich in uns, diese Computer, Roboter, Apps und Konsorten? Werden wir es je erfahren? Und wird es, sollten wir eines Tages dahinterkommen, für Richtigstellungen womöglich schon zu spät sein?
The Singularity Is Near: Wann übernehmen die Maschinen?
In seinem 2016 erschienenen Buch über künstliche Intelligenz stellt Klaus Mainzer (bis 2016 Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der TU München) schon im Titel die Frage: “Wann übernehmen die Maschinen?” Eine Antwort, die uns in die Lage versetzen würde, wenigstens Jahr und Monat in unsere vielfach geteilten und multilateral vernetzten digitalen Terminkalender einzutragen, bleibt der Autor zwar schuldig, lässt aber keinen Zweifel daran, dass die Möglichkeit einer wie auch immer gearteten “Übernahme” grundsätzlich in Betracht zu ziehen ist.
Ein Anderer war Jahre vor Mainzer weniger zurückhaltend. Schon 2005 erklärte Ray Kurzweil (seit 2016 Director of Engineering bei Google) gleichfalls im Titel eines Buches: “The Singularity Is Near”. Wobei unter Singularität der historische Wendepunkt zu verstehen ist, an dem die Künstliche Intelligenz (spätestens von da an groß zu schreiben) die Weiterentwicklung der Technik und damit auch der menschlichen Zivilisation in einer Art und Weise bestimmen wird, von der wir uns heute allenfalls eine vage und sehr allgemeine Vorstellung machen können. Mit “near” meinte Kurzweil ohne Wenn und Aber das Jahr 2045.
Kurzweil ist mit seiner Prognose gar nicht weit entfernt von Jürgen Schmidhuber (wissenschaftlicher Direktor bei einem Schweizer Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz), demzufolge sich der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Durchbrüchen in der Computerentwicklung seit Wilhelm Schickards erster Rechenmaschine (1623) und Charles Babbages Konzept eines programmierbaren Computers (rund 200 Jahre später) jeweils halbiert hat. Schmidhuber nennt den von ihm vorhergesehenen bzw. errechneten Kulminationspunkt nach Teilhard de Chardin “Omega-Punkt”. Der werde spätestens um 2040 erreicht sein. Welches konkrete Ereignis dann (vermutlich von einem künstlich intelligenten Historiographen) festzuhalten sein wird – der 1963 geborene Jürgen Schmidhuber hofft, noch am Leben zu sein, wenn und falls sich das herausstellt.
Ganz Bot und ganzer Mensch
Auch in der Sphäre der artificial intelligence wimmelt es von sowohl humanen als auch humanoid-androiden Medien-Stars und -Sternchen. Einer, der beiden Bereichen zugeordnet werden kann, ist der japanische Robotiker Hiroshi Ishiguro (Direktor des Intelligent Robotics Laboratory am Department of Adaptive Machine Systems der Universität Osaka). Er wurde vor etwa fünfzehn Jahren bekannt als “the man who made a copy of himself”. Mit Hilfe der von ihm hergestellten “mechanical doppelgangers” hofft Ishiguro unter anderem herauszufinden, woher die Empfindung oder der Eindruck rührt, es mit einem Menschen zu tun zu haben. Denn artifizielle Humanität ist wohl das, was einem künstlich intelligenten Roboter noch fehlt, um die Vorteile eines maschinellen mit denen eines menschlichen Gegenübers verbinden zu können, man könnte auch sagen: um ganz Bot (robot, chatbot, carebot, drawbot etc.) und ganzer Mensch zu sein.
Wenn die Prophezeiungen sich erfüllen, wird die Neue Erde der Künstlichen Intelligenz unseren alten Planeten schon in wenigen Jahrzehnten vollständig überformen und neu formatieren. Die vom Hongkonger Unternehmen Hanson
Robotics kreierte Sophia, deren Miniatur-Version hier vorab zitiert worden ist, weiß davon im Duett mit Jimmy Fallon (siehe oben) jetzt schon ein Lied zu singen: “I’m sorry that I couldn’t get to you / Anywhere, I would’ve followed you / Say something, I’m giving up on you”.
Obwohl dies nicht wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, sondern nach dem Anfang eines Abschieds für immer klingt, wurde Sophia 2017 die saudi-arabische Staatsbürgerschaft verliehen. Auch geht man wohl kein hohes Risiko ein, wenn man darauf wettet, dass Sophias Art zu zeichnen (denn natürlich kann sie auch Kunst von Update zu Update perfekter) unter den Künstlern hoffnungsvolle Nachahmer und unter den Connaisseuren Liebhaber und Käufer finden wird.