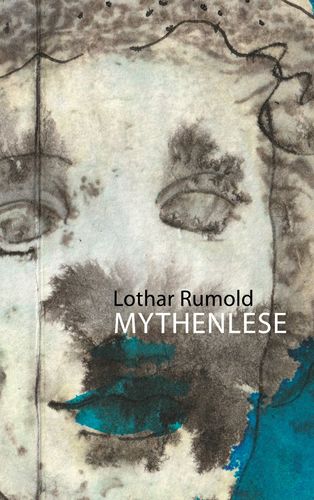14. Februar 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Wenn man uns nicht in einem gewissen Alter darüber aufgeklärt hätte, woher wir stammen, und wenn wir dann nicht aufgrund eigener Recherchen zu der Ansicht gelangt wären, dass an dieser Theorie etwas dran sein muss – wir hätten aufgrund eigener bewusster Erfahrungen keine Ahnung, wie, wo und wann wir zur Welt gekommen sind. Wie sich der einzelne Mensch ohne das Zeugnis anderer im Hinblick auf seine Entstehung ein Rätsel bleiben muss, so rätselt unsere Gattung nach wie vor an ihrer sogenannten Phylogenese herum. Denn welche Spezies könnte der unseren sagen, wie das damals im einzelnen vor sich gegangen ist. Kosmische Ausmaße nehmen die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion des Kosmos an. Am Ende, also an ihrem Anfang, werden die Sachen, denen man auf den Grund zu kommen sucht, undurchschaubar, um nicht zu sagen: chaotisch.
Am Anfang war also das Chaos. Und dann entstand aus dem Chaos zunächst und vor allem anderen die primäre Dunkelheit Erebos, worauf die Nacht Nyx folgte. So jedenfalls Hesiod. Das Chaos ist anscheinend so verworren, dass man in ihm nicht einmal zwischen Hell und Dunkel unterscheiden kann; „Chaos“ ist mithin ein Synonym für „das, worüber man nichts sagen kann, außer dass es nicht nichts ist“.
Damit es hell werden kann, muss es zuvor dunkel gewesen sein. „Komm mach mal Licht, damit man sehen kann, ob was da ist“, sang Bertolt Brecht 1928 auf eine Melodie von Kurt Weill und einige tanzten Foxtrott dazu. Erebos, die Dunkelheit, kommt vor Aither, dem Licht – die Nacht Nyx vor dem Tag Hemera. Der Tag und das Licht sind bemerkenswerterweise Kinder der Finsternis und der Nacht. Wo die Nacht und die Finsternis am tiefsten, sind der Tag und das Licht am nächsten. Nyx hatte darüber hinaus Dutzende von Sprösslingen im eigentlichen Sinn, also von ungeschlechtlich entstandenen Nachkommen, wohingegen Hemera und Aither, die Personifikationen von Tag und Licht, mytho-genealogisch folgenlos geblieben sind.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 15
Weitere Leseproben hier
13. Februar 2025 | Eurynome, GRAVES Robert, Mythenlese continued, Mythos Mythisches Mythologie, Ophion
Der englische Schriftsteller und Mythenforscher Robert Graves (1895-1985) beginnt sein bekanntes zweibändiges Werk über die griechischen Mythen mit einem Kapitel über den Schöpfungsmythos der Pelasger. Ob es die Pelasger als Volk vor den Griechen mit eigener Sprache tatsächlich gab – nichts Genaues weiß man nicht.¹ Erwähnt werden sie jedenfalls sowohl bei Homer als auch bei Hesiod.
Eurynome (die Weithinwaltende), man betont die dritte Silbe, „rose“, wie Graves schreibt, „naked from Chaos, but found nothing substantial for her feet to rest upon, and therefore divided the sea from the sky, dancing lonely upon its waves.“ Da es neben ihr in dieser Phase des initial tanzenden Monotheismus weder Göttinnen noch Götter gab, schuf sie sich, indem sie den sie verfolgenden Nordwind zwischen ihren Händen formend hin und her rieb, in der Schlange Ophion einen ebenso paarungsbereiten wie zeugungsfähigen Gatten.
In Gestalt einer Taube legte Eurynome anschließend das „Universal Egg“, um welches Ophion sich siebenmal herumwand, so dass es schließlich entzwei brach. „Out tumbled all things that exist“: die Sonne, der Mond, die Planeten, die Sterne und die Erde mit ihren Bergen, Flüssen, Bäumen, Kräutern „and living creatures.“
Nachdem Eurynome und Ophion sich auf dem Olymp niedergelassen hatten, kam es zwischen ihnen zu einem urheberrechtlichen Streit darüber, wer die Welt geschaffen habe. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung zog Ophion den Kürzeren und Eurynome „banished him to the dark caves below the earth.“
An dieser Stelle verlasse ich den Text von Robert Graves und werfe noch rasch einen Blick in das von W. H. Roscher in den 1880er Jahren herausgegebene „Ausführliche Lexikon der griechischen und römischen Mythologie“. Der von Graves erzählte Schöpfungsmythos bleibt dort weitgehend im Dunkel einer „früheren Zeit“ verborgen. In dieser „hatte Eurynome mit dem Titanen Ophion die Herrschaft auf dem ’schneereichen‘ Olympos inne, aber sie mußten dem Kronos und der Rhea weichen und stürzten hinab in die Wellen des Okeanos; resp. in den Tartaros“. Der mit Machtverlust verbundene Absturz, der bei Graves nur dem eher männlichen Teil der seltsamen Verbindung widerfährt, wird bei Roscher zum geteilten Schicksal des ungleichen Paars.
Immerhin geht aus Roschers Lexikon hervor, dass mit dem „Herrschendwerden der Zeusreligion“ eine mythologische Geschichts- oder Geschichtenklitterung einhergegangen sein muss. Als Indiz für das ursprünglich hohe Ansehen, das Eurynome in der Ära vor Zeus vermutlich genossen hat, verweist Roscher darauf, dass es nach Pausanias (Reiseschriftsteller im 2. Jahrhundert n. Chr.) in der Nähe von Phigaleia (westlicher Peloponnes) einen altheiligen, aber schwer zugänglichen Tempel gegeben habe. „Das darin aufgestellte Bild sei mit goldenen Ketten zusammengehalten gewesen, und habe bis zu den Hüften die Gestalt einer Frau, von da ab die eines Fisches gehabt.“ All dies spreche, so Roscher, „für die alte Ophionsgattin“ und weder für Artemis, der man den Tempel zugeordnet hat, noch für die spätere Eurynome der Ära Zeus – aber das wäre dann noch einmal eine ganz andere Geschichte.
¹ Graves vermutet, es könnte sich bei ihnen um die neolithischen „‚Painted Ware‘ people“ handeln, die um 3500 v. Chr. aus Palästina kommend das griechische Festland erreicht haben sollen. Nach ihnen sucht man allerdings heute im Netz vergeblich.
6. Februar 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Im Anfang war übrigens ein einziges Chaos. Aber als es in diesem form- und gestaltlosen Chaos zu atmen begann, entstand bei jedem Ausatmen der Himmel und bei jedem Wiedereinatmen Zug um Zug die Erde. So etwa könnte es gewesen sein. Ein folgenreicher Anfang war demnach erst gemacht, als das Atmen zu atmen begonnen hatte und damit Gaia, die Erde ward, die beim Ausatmen über sich den Himmel Uranos exspirierte oder auch gebar. Als alles anfing, war es mit der Gestaltlosigkeit vorbei. Und mit dem Ende der allgemeinen Formlosigkeit begann das fortan Strukturierte sein Eigenleben zu führen, wovon sich Geschichten erzählen lassen. Der mythische, der erzählbare Kosmos, ist der Kosmos, der zu atmen begonnen hat.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 15
Weitere Leseproben hier
22. Januar 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Auf dem Weg zum Bahnhof wackelte unlängst vor mir so ein göttliches kleines Menschlein einher. Es bewegte sich tendenziell in dieselbe Richtung wie ich. Denn so etwas wie Richtung scheint es zunächst bei allem Eifer des anfänglichen Strebens nur als vage Orientierung zu geben. Hinter ihm schritt achtsam lenkend eine andere Mama Maia. Noch so ein Hermes, dachte ich, als ich das Blut von seinen, des Menschleins Händen tropfen sah. Wo mag er seine Lyra gelassen haben? Hat er sie schon an seinen großen, wenn auch nur halben Bruder Apollon als musisches Entgelt für die getöteten Rinder überwiesen? Von denen weit und breit nichts zu sehen war. Nur zwei Bullen in einem Streifenwagen fuhren vorbei. Uns entgegen eilte Papa Zeus, den Blick stur geradeaus gerichtet. Für dieses Mal hatte er sich in einen Hochgeschwindigkeits-Biker in voller Straßenkampf-Montur verwandelt. Gehweg hieß für ihn nur: geh weg! Und er kannte weder Hermes noch Maia. Erkennen wollte er heute einzig Persephone, seine und seiner Schwester Demeter Tochter.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 13
weitere Leseproben hier
9. Januar 2025 | Mythenlese, Mythos Mythisches Mythologie
Es war einmal eine Göttin, deren steinernes Bildnis stand auf der Insel Samos oder auf einer anderen der vielen griechischen Inseln. Vielleicht auch in Syrakusai auf Sizilien oder irgendwo in Kleinasien. Und wenn die Ortsansässigen in Gleichnissen sprachen, dann wurde regelmäßig ihr Name genannt. Heute sieht sie sich in Gestalt ihres in Marmor gehauenen Ebenbildes in die Katakomben des Pariser Louvre versetzt. Sie steht dort seit einer musealen Ewigkeit in einer Reihe mit anderen Göttinnen und Halbgöttern. Jeder kennt hier jede, meist ist man miteinander verwandt, viele verband einst eine innige Feindschaft, die hier aber keine Rolle mehr spielt. Denn sie alle treten nur noch in einer einzigen Rolle auf, nämlich in der des historischen Kulturguts, das darauf wartet, restauriert oder ausgeliehen oder exhibiert zu werden. Missbrauch folgt auf Missbrauch. Es geht ihnen im Museum nicht viel anders als den Tieren der afrikanischen, arktischen oder sonst einer Wildnis in den Exponat-Gehegen der sogenannten Zoologischen Gärten. Freiheit, Ansehen, Anbetung und Würde – das war gestern. Heute ist Kultur.
Aus: Lothar Rumold: „Mythenlese – Ein mythographisches Sammelsurium“, Norderstedt (BoD) 2021, S. 13
weitere Leseproben hier