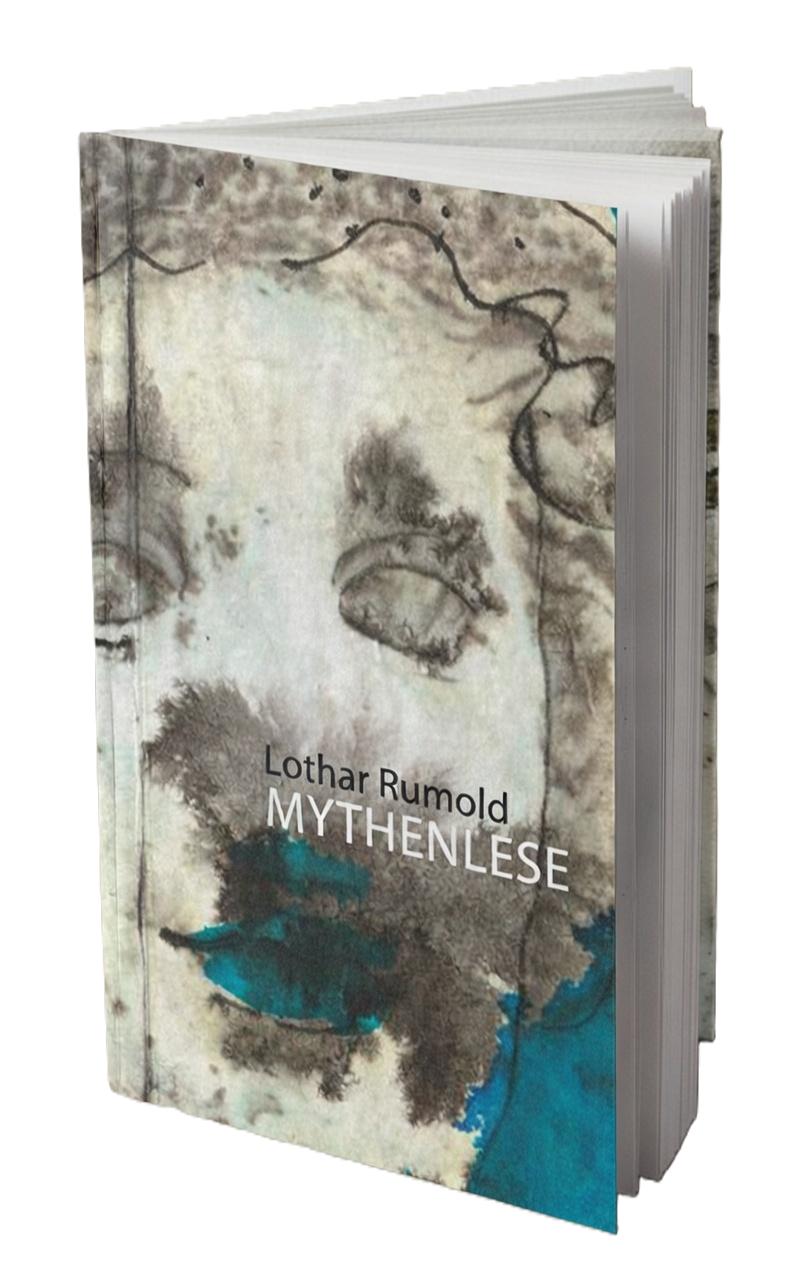Passionsspiele – Roman in Briefen (Folge 1: Vorwort)

Vorwort des Verfassers
Dass die nachfolgenden „Briefe“ und „Postkarten“ und die ihnen vorangestellte „E-Mail“ echt sind, glaubt mir wahrscheinlich sowieso niemand. Also will ich gar nicht erst versuchen, sie dem Leser und der Leserin in einem dann genauso wenig glaubwürdigen Vorwort als Zeugnisse real gelebten Lebens zu verkaufen. Etwa so wie das Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos getan hat, als er in seinem Briefroman „Gefährliche Liebschaften“ den sogenannten Briefen ein „Vorwort des Sammlers dieser Briefe“ vorausgeschickt hat, aus dem hervorzugehen scheint, dass es sich um die Wiedergabe von Briefen im eigentlichen Sinn und nicht um das fingierte Machwerk eines (wenn man so will) Ghostwriters handelt, der das alles nur erfunden hat.
Natürlich ist dieses Sammler-Vorwort Teil der schriftstellerischen Fiktion und auch die dem Vorwort vorausgehende „Vorbemerkung des Herausgebers“, worin die Authentizität der sogenannten Briefe und demzufolge auch der Wahrheitsgehalt der eben erwähnten Vorbemerkung im voraus stark in Zweifel gezogen wird, steht noch im Roman und nicht außerhalb desselben, da durch sie der fiktionale Charakter des Vorworts nicht erkennbar gemacht, sondern bekräftigt wird – oder so ähnlich.
Liest das noch jemand oder bewegt sich mein sprachliches Gebilde schon hier in der gespenstischen Sphäre des ungelesenen Textes, über dessen Sein oder Nicht-Sein sich ein Philosophen-Leben lang streiten ließe? Was ich nur sagen wollte und vor diesem Ausflug in die psychologisch komplex und doppelbödig angelegte Literatur eines französischen Briefromanschreibers des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts bereits gesagt hatte: auch das hier Veröffentlichte ist wahrscheinlich gar nicht wahr. Obwohl der Holzbildhauermeister, von dem ich die angebliche Abschrift der vorgeblich bei der Auflösung seiner Werkstatt verloren gegangenen Briefe und Karten erhalten habe, ebenso steif wie fest behauptet hat, dass er die Original-Dokumente selbst in Händen gehalten habe.
Sein später in Karlsruhe lebender Vater sei um 1960 herum sechs Jahre lang in Oberammergau gewesen, um dort als Schnitzer zu arbeiten und zu guter Letzt auch noch die Meisterprüfung abzulegen. In dieser Zeit habe er, der Vater, die Briefe und Postkarten geschrieben und seinerseits Karten und Briefe, und viele Jahre später auch noch eine einzelne E-Mail, von verschiedenen Personen zugesandt bekommen. Die ganze Sammlung habe er, der Sohn, in mehreren Schuhkartons im Nachlass seiner Mutter gefunden. Kann man das glauben? Bei vielen der sogenannten Abschriften frage ich mich nämlich, wie die Originale den Weg in die mütterlichen Schuhkartons gefunden haben sollen.
Was bei mir von Anfang an den Verdacht aufkommen ließ, dass er mich mit diesem Narrativ zum Narren halten wollte, war der Umstand, dass mir der Holzbildhauer, der übrigens danach spurlos verschwunden ist, erzählt hat, er habe eigentlich immer Schriftsteller werden wollen und sei nur versehentlich in die Fußstapfen seines Vaters getreten, nachdem er dreizehn Jahre lang in Berlin und Heidelberg dies und das studiert hatte, ohne dass dabei etwas beruflich Verwertbares herausgekommen war.
Auf meine Frage, warum er das Konvolut gerade mir zu treuen Händen und zur ebenso uneingeschränkten wie bedingungslosen weiteren Verwendung überlassen wolle, antwortete er, dass er auf mich im Internet („wo denn sonst“) gestoßen sei. Und da habe er intuitiv gespürt, dass ich schon wissen werde, wie nun „mit dem ganzen Zeug“ zu verfahren sei. Er selbst habe, nachdem er mit der Abschrift fertig gewesen sei, gedacht, dass man daraus „vielleicht ein Buch machen könnte“. Aber wenn mir etwas anderes oder gar nichts einfallen würde, dann solle ich eben etwas anderes oder gar nichts damit machen. Er wolle damit jedenfalls „nichts mehr zu tun haben.“ Doch habe ihn die Abschrift viel Zeit und Mühe gekostet und bei mir, dessen sei er sich sicher, bestehe immerhin die Chance, dass er „diese passionsartige Tortur“, die wegen der Konfrontation mit der Gedanken- und Gefühlswelt seines Vaters auch „eine geistig-seelische“ gewesen sei, nicht umsonst durchlitten habe. Wie schon gesagt, sei dieser Leidensweg für ihn jetzt aber zu Ende. Öffentlich ans Kreuz schlagen lassen werde er sich für die Briefe seines Vaters nicht. Stattdessen habe er jetzt vor, ganz allmählich zu verschwinden.
Ein in Berlin lebender Schweizer Schriftsteller habe ihn darauf gebracht und bei ihm habe er auch gelesen, wie man das macht. Man lässt nach und nach immer weniger von sich hören oder sehen, wechselt mehrmals den Wohnsitz, kündigt Verträge, zuletzt auch noch den mit dem Mobilfunk-Anbieter, gibt keine Adresse mehr an, vergrault die wenigen Freunde und Bekannten, die man noch hat, äußert sich nicht mehr, weder privat noch öffentlich, wird unerreichbar und unauffindbar, gerät dann nach und nach, unterm Strich aber erstaunlich schnell, in Vergessenheit und ist damit irgendwann so gut wie nicht mehr existent. Wie er darauf kam, dass man ihn wegen der Briefe seines Vaters ans Kreuz schlagen könnte, sagte er nicht. Insgesamt machte er auf mich schon jetzt einen leicht abwesenden Eindruck.
Ich habe den Stapel Papier (er hatte mir keine Datei, sondern beidseitig bedruckte Blätter mit handschriftlichen Randnotizen dagelassen) erst einmal ein paar Wochen lang ignoriert. Was soll ich mit den Briefen eines Oberammergauer Herrgottschnitzers (egal ob echt oder erfunden) anfangen, dachte ich. Lebe ich vielleicht im neunzehnten Jahrhundert? Heiße ich etwa Ludwig Ganghofer? Stattdessen beschäftigte ich mich mit Kleinkram: eine Rede anlässlich der Eröffnung einer Kunstausstellung hier, ein Text für einen Ausstellungskatalog dort. Auch ein Aufsatz über die Rolle der griechischen Mythen in der modernen Astrologie als Beitrag für ein esoterisches Online-Magazin war dabei. Gleichzeitig tüftelte ich in Zusammenarbeit mit einer KI an einer Romanfigur, deren Artifizielle Psyche (AP) im Hinblick auf Komplexität und Therapiebedürftigkeit jeder natürlichen in nichts nachstehen sollte.
Als sich nicht nur bei mir, sondern auch bei der KI die Anfänge einer Schreibblockade bemerkbar machten, beschlossen wir, eine kreative Pause einzulegen. Diese wollte ich als erstes nutzen, um meinen Arbeitsplatz und dessen Umgebung zu säubern und aufzuräumen, also Bücher zurück ins Regal und benutzte Tassen und leere Kuchenteller in die Spülmaschine zu stellen. Dabei fiel mir der Stapel mit den Oberammergauer Briefen in die Hände und ich begann zu lesen. Gar nicht so uninteressant, dachte ich nach etwa zwei Stunden, daraus lässt sich vielleicht doch etwas machen.
An den damit beginnenden Schreib- und Umschreibprozess denke ich mit durchaus gemischten Gefühlen zurück. Nach wie vor frage ich mich, ob es aus publikationsmoralischer Sicht erlaubt ist, einen fremden Text durch Hinzufügungen und Weglassungen so zu verändern, dass sein ursprünglicher Grundcharakter stark beeinträchtigt, wenn nicht sogar völlig zerstört wird. Und falls dieses Manuskript tatsächlich dokumentarischen Charakter hatte, war meine Vorgehensweise doppelt und dreifach fragwürdig. Die von mir vorgenommenen Eingriffe hielt ich für erforderlich, um aus dem, was mir der Holzbildhauer übergeben hatte, das Buch zu machen, das nach seinem Dafürhalten vielleicht daraus gemacht werden konnte. Denn seltsamerweise hatte ich nun das deutliche Gefühl, von ihm genau damit beauftragt worden zu sein.
Wenn man eine Mission zu erfüllen hat, darf man aufkommende Skrupel schon einmal beiseite wischen. Was meinen Gewissensbissen darüber hinaus den schmerzhaften Druck nahm, war der Umstand, dass ich, wie schon mehrfach erwähnt, begründbare Zweifel an der Authentizität des angeblichen Dokuments hegte. Außerdem habe ich nun in diesem Vorwort eine Art Geständnis abgelegt und meine Vorgehensweise im Prinzip, wenn auch nicht im Detail, offengelegt und begründet. Sollte eine Leserin oder ein Leser bei einzelnen Teilen des nachfolgenden „Romans in Briefen“ Fragen in Bezug auf deren Zustandekommen an mich haben, so bin ich gerne bereit, diese zu beantworten.
L. R. im Januar 2026
P. S.: Natürlich habe ich versucht, das mir überlassene Material auf seine Echtheit oder Falschheit hin zu überprüfen, bin dabei aber zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ob es in Oberammergau um 1960 einen Holzbildhauer namens Trost gab, der für die Holzschnitzerei Kurtz selig Erben gearbeitet hat, konnte man mir dort nicht sagen. Die alten Geschäftsunterlagen seien zwar noch vorhanden, momentan aber nicht zugänglich. Das Ergebnis meiner Recherche in Bezug auf Karlsruhe legt immerhin den Schluss nahe, dass entweder der Name der Stadt, der des Holzbildhauers oder die ganze Geschichte nicht stimmt. Weder bei der Handwerkskammer noch sonst irgendwo fand sich ein Hinweis darauf, dass es in Karlsruhe nach der angeblichen Rückkehr des Briefschreibers und -empfängers einen Holzbildhauermeister namens Tobias Trost gegeben hat.
Folge 2 (demnächst in diesem Theater)